
„Der Austritt ist nur der exponierteste Teil des Problems“
Politikwissenschaftlerin Annegret Eppler analysiert im „Thema Vorarlberg“-Interview den beabsichtigten EU-Austritt Großbritanniens und den aktuellen Zustand der Europäischen Union. „Der Brexit hat den multiplen Krisen der Union eine deutliche Stimme verliehen“, sagt die Wissenschaftlerin. Die EU werde überleben – aber sich deutlich ändern müssen.
Warum sind die Briten raus?
Es gibt viele Theorien, die Gründe für die europäische Integration angeben, aber keine Theorie der europäischen Desintegration. Dem muss sich die Wissenschaft jetzt stellen. Besser erforscht ist der Fall, dass ein Teil aus einem Nationalstaat austreten möchte, etwa Katalonien aus Spanien. Hier werden historische, kulturelle, religiöse oder ethnische Eigenheiten einerseits und die ökonomische Fähigkeit andererseits als kausal angesehen. Übertragen auf den Brexit hieße das: Die Briten haben sowohl eine sehr eigene Tradition und Identität als auch die wirtschaftliche Stärke, den EU-Austritt zu bewältigen. Die Form der Entscheidung spielt auch eine Rolle – Referenden sind basisdemokratisch, eröffnen aber auch eine Plattform für populistische und sachfremde Argumente.
Jeder Staat in der EU hat seine eigene Identität und Tradition – warum tritt ausgerechnet Großbritannien aus?
Die Briten haben neben Europa andere politische Bezugskreise: die englischsprachige Welt, vor allem die transatlantischen Beziehungen, und das Commonwealth. Als der damalige britische Premier Winston Churchill 1946 unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg in Zürich anregte, die „Vereinigten Staaten von Europa“ zu gründen, hatte er nicht die Vorstellung, dass Großbritannien ein Teil davon sein sollte. Verglichen mit den Gründerstaaten der europäischen Integration, etwa Italien und Frankreich, hatten die Briten ein etwas zwiespältiges Verhältnis zum europäischen Festland.
Quasi britisch unterkühlt?
Ja, oder in der Sichtweise der Briten womöglich ein bisschen europäisch vereinnahmend (lacht). Großbritannien hatte in der europäischen Integration schon immer eine Sonderrolle. Britische Beitrittsgesuche scheiterten 1961 und 1967 an Frankreichs damaligem Präsidenten Charles de Gaulle. Nachdem 1973 der Beitritt gelungen war, bestanden im Vereinigten Königreich Zweifel, die schon 1975 zu einem Austrittsreferendum führten. Damals stimmten zwei Drittel der Briten für den Verbleib in der Europäischen Gemeinschaft. Margaret Thatcher hat 1984 den sogenannten „Britenrabatt“ durchgesetzt, einen ökonomischen Sonderstatus im Hinblick auf den europäischen Haushalt. 1990 trat Großbritannien dem Europäischen Währungssystem, Vorläufer der Währungsunion, bei, aber schon 1992, nach einer bitteren Krise des Pfunds, wieder aus. Heute ist es an etlichen EU-Politiken nicht beteiligt. Betroffen sind die Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die Innen- und Justizpolitik, der Schengenraum, der Euro und die Grundrechtecharta. Nach dem „Deal“, den der britische Premier Cameron im Februar 2016 für den Fall eines Verbleibs in der EU ausgehandelt hatte, wäre Großbritannien zwar formal Mitglied geblieben, hätte sich faktisch aber noch weiter entfernt. Großbritanniens Politik war es, sich das beste zweier Welten zu sichern.
Dennoch, mit einem Ja zum Brexit hat doch bis zuletzt kaum jemand gerechnet …
Wissenschaftler haben nicht damit gerechnet, Medien nicht, Meinungsforschungsinstitute nicht. Das ist bemerkenswert: Die Briten diskutieren monatelang über den Austritt, die Sache steht offensichtlich auf der Kippe, und jetzt sind wir plötzlich alle erstaunt.
Realitätsverlust?
Oder zumindest Ausblendung eines Teils der Realität. Nach dem Zweiten Weltkrieg mit seinen Millionen Toten war die europäische Integration eine atemberaubende Errungenschaft. Sie hat uns jahrzehntelang Frieden, Stabilität und Sicherheit in Freiheit gebracht. In den 1950er-Jahren hatten sich zunächst sechs Staaten zusammengeschlossen. Ihre Einigung brachte derart viele Vorteile, dass nach und nach weitere 22 Staaten beigetreten sind. Ökonomischer Wohlstand, Arbeitnehmerrechte, Mobilität, Umweltschutz – die EU bringt viel für die Menschen. Vielleicht hat diese Erfolgsstory dazu verleitet, Hoffnungen mit Analysen zu vermischen und die Kehrseite auszublenden: dass es auch einmal zu einer teilweisen Abkehr vom Ziel einer immer engeren Union kommen kann. Von allen anderen „Mehrebenensystemen“, also etwa von Föderalstaaten wie Österreich oder der Schweiz, ist bekannt, dass sie sich keineswegs immer weiter in Richtung Bund zentralisieren, sondern immer auch Entwicklungen in Richtung der Länder stattfinden. Für das EU-System hat man die Möglichkeit, dass sich einiges auch wieder „von Brüssel weg“ entwickeln könnte, kaum einbezogen. Und vor Krisensymptomen erstaunlich lange die Augen verschlossen …
Frei nach dem Motto: „Krise? Welche Krise“?
Es sind tatsächlich multiple Krisen. Ökonomisch ist die sogenannte „Eurokrise“ noch nicht überwunden. Mehrere Staaten standen vor dem Bankrott, Griechenland vor dem Rauswurf aus dem Euroraum. Auch politisch gerät die EU unter Druck, die „Subsidiarity Review“ der niederländischen Regierung 2013 schlägt beispielsweise vor, bestimmte EU-Gesetzgebungskompetenzen wieder den Nationalstaaten zurückzugeben. Einige EU-Staaten fühlen sich in der so genannten „Flüchtlingskrise“ nicht mehr an das gemeinsam gesetzte europäische Recht gebunden. Sie zeigt, wie verschieden die Meinungen sind und wie wenig man zu einer gemeinsamen Linie in der Lage ist. Diese Legitimitätskrise äußert sich unter anderem darin, dass laut Eurobarometer die Zustimmungsrate zur EU, die 2007 noch über 50 Prozent lag, in den Jahren 2012 bis 2014 auf um die 30 Prozent gesunken ist. Im Frühjahr 2015 waren es dann wieder über 40 Prozent. Europaskeptische Parteien haben in vielen EU-Staaten Erfolge auf Landes- und Bundesebene erzielt und sind, wenn auch nicht in einer einheitlichen Fraktion, im Europäischen Parlament vertreten.
Ist das Hauptproblem die Legitimitätskrise? Ist die EU überhaupt demokratisch?
Der frühere US-Präsident Abraham Lincoln sah Demokratie als „Herrschaft des Volks durch das Volk für das Volk“. Zu Beginn konnte die europäische Integration sich über ihren Output – das, was sie für das Volk bringt – legitimieren. Europa war nach dem Zweiten Weltkrieg ein Elitenprojekt. Aus der wirtschaftlichen Integration sollte Schritt für Schritt auch die politische und gesellschaftliche Integration erwachsen, in einer Art Automatismus, weitgehend ohne aktiven Willensakt der Bevölkerungen. Damit wurden immense Integrationsfortschritte erzielt. Erst mit dem Nein der Dänen zum Maastrichter Vertrag 1992 und dem Nein der Niederländer und Franzosen zum Europäischen Verfassungsvertrag 2005 wurde deutlicher, dass es zumindest Teilen der Bevölkerungen mit der Richtung, die die europäische Integration nimmt, nicht wohl ist. Wie in Lincolns Definition muss neben einer Output-Legitimation die Input-Legitimation stehen: Die Menschen wollen aktiv mitentscheiden.
Genau das war eine Forderung der Brexit-Befürworter: die Kontrolle zurückholen …
Der Wunsch nach Kontrolle ist ein Reflex: Terrorismus, Klimawandel, Pandemien, Finanzmärkte und Flüchtlingsströme hören nicht an Staatsgrenzen auf. Hochkomplexe Entscheidungen müssen getroffen werden. Viele Menschen befürchten, dass die Politiker überfordert sein könnten. Das führt zu Politikverdrossenheit und gewandelten Protestkulturen. Die verflochtene Welt ist eine Herausforderung für die Demokratie an sich und die EU dabei ein Kristallisationspunkt. In Brüssel werden Entscheidungen gemeinsam mit anderen Staaten getroffen, die eigene Regierung kann überstimmt werden, das direkt gewählte Europäische Parlament entscheidet meistens mit. Derartige „Zwei-Ebenen-Spiele“ sind intransparent. Wenn es brenzlig wird, werden die gegenseitigen Abhängigkeiten bewusst und der Ruf nach Kontrolle wird laut. Die Frage ist, ob ein Staat alleine in der Lage ist, die grenzüberschreitenden Probleme zu lösen. Die Kontrolle kann womöglich nur noch gemeinsam ausgeübt werden.
Ist das nicht gegen den eigentlichen Volkswillen? In vielen EU-Staaten gibt es europaskeptische Parteien.
Was wir sehen, ist eine innenpolitische Politisierung und Polarisierung entlang europapolitischer Themen. Tatsächlich feiern europaskeptische Parteien wie die niederländische PVV, der französische Front National, die deutsche AfD, die italienische Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega Nord, die FPÖ in Österreich, die PiS in Polen und die Fidesz in Ungarn Erfolge. Aber in allen diesen Staaten existiert auch eine erhebliche Zahl „Europafreunde“: 55 Prozent der Europäer fanden laut Eurobarometer im Herbst 2015, dass ihr Land als EU-Mitglied besser für die Zukunft gerüstet sei, nur 34 Prozent sahen bessere Chancen ohne die EU. In Großbritannien gab es eine Lagerbildung jung gegen alt, Städte gegen Land, Engländer und Waliser gegen Schotten und Nordiren.
Ist der Brexit also der Anfang vom Ende der EU?
Er ist jedenfalls definitiv die bisher größte Krise der EU. Der Austritt Großbritanniens ist ja nur der exponierteste Teil des Problems. Aber vielleicht ist der Brexit ja auch ein Weckruf und verwandelt die Krise in eine Chance?
Das klingt jetzt aber sehr nach einer Durchhalteparole …
Totgesagte leben länger. Im Moment sind die Folgen des Brexits kaum kalkulierbar. Klar ist, dass die Union sich verändern wird. Strategiepapiere werden lanciert. Der Handlungsspielraum derjenigen, die jetzt erst recht einen weiteren Ausbau der EU verlangen, ist innenpolitisch durch die Europaskeptiker begrenzt. Aber auch die Rufe einiger populistischer Parteien nach weiteren Austritten – Nexit, Öxit – werden durch die lauter werdende, wenn auch knappe, Mehrheit der Europafreunde gebremst. Es ist möglich, dass es zu weiteren Differenzierungen und Gruppenbildungen kommt, weil einzelne Staaten unterschiedliche Vorteile der EU ausbauen oder nicht abbauen wollen. Bei all diesen Optionen ist es das Wichtigste, die Menschen ernst zu nehmen.
Vielen Dank für das Gespräch!



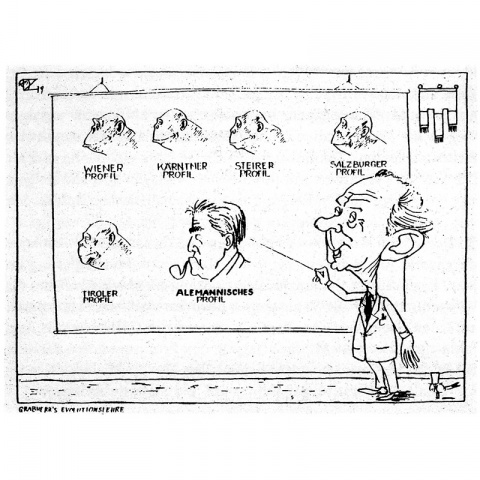



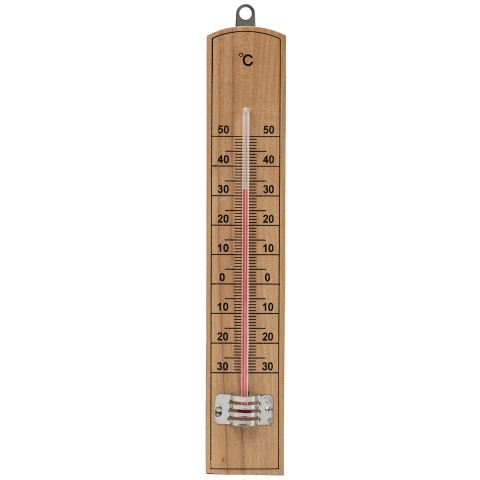

Kommentare