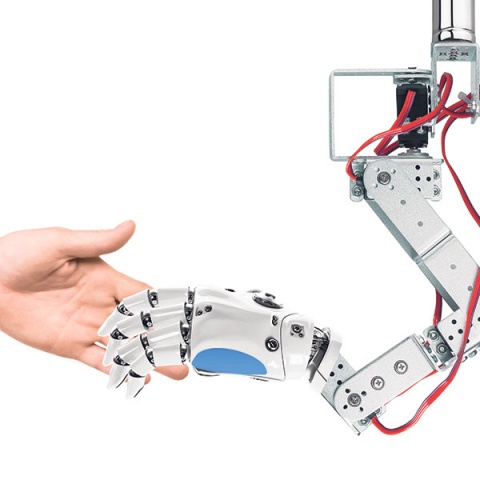
Erfolgsfaktor Kreativität
Wir sollten spielen, statt angstvoll auf die Digitalisierung zu starren.
Wir befinden uns an einer Epochenschwelle. Die rasante Entwicklung der Informationstechnologie öffnet dem Menschen des 21. Jahrhunderts Optionen und Perspektiven, von denen noch vor 50 Jahren niemand zu träumen vermochte. Wenn wir den Verheißungen der IT-Giganten des Silicon Valley wie Google oder Facebook Glauben schenken, dann wird es in wenigen Jahren möglich sein, die Grenze zwischen organischer und künstlicher Intelligenz zu überwinden und menschliche Gehirne direkt mit Computern und Datennetzen zu verbinden. So weit sind wir noch nicht, aber die Welt der Arbeit tangiert es schon jetzt: Hier schreitet die Digitalisierung rasant voran, und mit ihr kommen Robotisierung und Cyborgisierung. Kein Zweifel ist mehr möglich: Die Arbeit, wie wir sie kannten, wird zur Ausnahme werden. Was man heute Industrie 4.0 nennt, gibt einen Vorgeschmack darauf. Vielen macht diese Entwicklung Angst – aus verständlichen Gründen. Mehr als Angst einzuflößen sollte sie uns jedoch zu denken geben und Fragen aufwerfen: Welche Chancen liegen in dieser Dynamik? Was macht sie mit uns Menschen? Vor allem aber: Wie können wir mit ihr Schritt halten?
Erkenne dich selbst!
Diese Fragen sind nicht unerheblich. Dass sie überhaupt gestellt werden, lässt sich als Symptom dafür deuten, wie gravierend die Epochenschwelle ist, an der wir uns befinden. Denn tatsächlich stellt die Entwicklung – nicht nur der Informationstechnologie, sondern auch der Biotechnologie, der Gentechnik und der Nanotechnologie – unser Selbstverständnis radikal infrage. Sie nötigt dazu, uns darauf zu besinnen, wer wir eigentlich sind. Die Chancen für ein neues, avanciertes Verständnis des Menschseins stehen gar nicht schlecht – zumindest dann nicht, wenn wir der Versuchung widerstehen, uns nach Maßgabe unserer Maschinen zu deuten. Wer solches tut – und leider neigen dazu viele Menschen –, kann eigentlich nur noch misanthropisch werden, denn er wird nicht umhinkommen, die unwiderrufliche „Antiquiertheit des Menschen“ (Gunter Anders) zu konstatieren und die Mangelhaftigkeit des Menschenwesens zu beklagen.
Descartes Irrtum
Groß ist diese Versuchung deshalb, weil sich der Mensch der Neuzeit seit den Tagen eines René Descartes angewöhnt hat, seinen Stolz und seine Würde auf seine Rationalität zu gründen. „Ich denke, also bin ich“, sprach der Denker – und ebenso mögen die Wunderwerke der Künstlichen Intelligenz bald reden und uns beweisen, dass sie nicht nur sehr viel schneller, besser, effizienter denken können, sondern deshalb auch die besseren Menschen sind. Auf dem Feld des Denkens brauchen wir mit den Maschinen, die wir bauen, nicht zu konkurrieren. Dabei können wir nur verlieren.
Wie aber, wenn Descartes Sicht auf den Menschen in die Irre führt? Wie, wenn es nicht das Denken ist, das Menschen eigentlich zu Menschen macht? Was könnte sonst den Adel unserer Spezies auszeichnen? Descartes gibt uns noch eine andere Antwort, wenn er sagt, des Menschen Würde liege darin, als „Herr und Meister“ über die Natur zu herrschen. Als Homo Faber, als ein Macher und als Produzent, erfülle sich das Menschsein; was der modernen Misanthropie freilich nur weitere Nahrung gibt: Denn was das Können und die Effizienz der Produktion und Kalkulation angeht, sind uns schon die Roboter von heute himmelweit überlegen.
Menschsein erfüllt sich im Spiel
Wir können weder auf dem Feld der Technik noch auf dem des Denkens und Berechnens mit Maschinen konkurrieren. Was also bleibt vom Menschen? Ein Vorschlag kommt – nicht zufällig – von einem unserer großen Dichter. Die Rede ist von Friedrich Schiller, denn er war es, der einst sagte, der Mensch sei eigentlich nur da ganz Mensch, wo er spiele – denn wo er spielt, da ist er schöpferisch, da ist er kreativ. Und eben darin liegt das entscheidende Alleinstellungsmerkmal des Menschen, das ihn nicht nur von allen anderen Wesen unterscheidet, sondern auch von den Maschinen, die er sich geschaffen hat: in seiner Kreativität.
So sah es nicht erst Schiller, so sah es schon einer der größten Vordenker der Renaissance: Giovanni Pico della Mirandola behauptete in seiner Rede über die Würde des Menschen von 1487, das Wesen eines Menschen erfülle sich darin, sich wie ein Künstler zu seinem eigenen Leben zu verhalten und seinem Schöpfer darin zu entsprechen, selbst schöpferisch zu sein. Wobei sich Pico dessen wohl bewusst war, dass künstlerisches Schaffen etwas völlig anderes ist als die technische Herstellung, die unsere Maschinen so gut beherrschen: dass künstlerische Kreativität nichts anderes ist als Spielen.
Unser Gehirn ist ein Spielzeug
Was Schiller ebenso wie Pico ahnte, findet heute durch die Hirnforschung Bestätigung: Das menschliche Gehirn ist keineswegs – wie es der Homo Faber gerne hätte – ein gutes, dabei gleichwohl optimierbares Instrument zweckrationaler und nutzenorientierter Kalküle, sondern ein Spielzeug. Gewiss kann es auch von der instrumentellen Rationalität vereinnahmt werden, aber eigentlich wird es dadurch missbraucht, denn zu Höchstform läuft es erst dann auf, wenn es spielen darf. Dann erst zeigt sich, was in ihm steckt: ein unerschöpfliches Potenzial an Kreativität. Der Grund dafür ist längst bekannt, denn niemand kommt auf eine neue, kreative Idee, wenn er sich anstrengt, wenn er sich unter Druck gesetzt fühlt oder von starken Affekten getrieben ist. Vielmehr haben Menschen nur dann kreative Einfälle, wenn sie ohne Druck, frei und unbekümmert, also spielerisch in der Lage sind, ihre Gedanken einfach laufen zu lassen und abzuwarten, was sich dann wie von selbst zusammenfügt. Bei manchen passiert das unter der Dusche, bei manchen im Bett oder beim Spazierengehen. Zweckfrei und absichtslos, also spielerisch, sind sie mit ihren Gedanken unterwegs.
Mäander statt Kanäle
Zweckfreiheit und Absichtslosigkeit sind freilich das genaue Gegenteil dessen, was die instrumentelle Vernunft verlangt, die unsere Arbeitswelt beherrscht. Ihr geht es um Effizienz und Zielstrebigkeit. Für ihren Workflow gräbt sie am liebsten gerade Kanäle. Das erscheint ihr rational. Ganz anders die Intelligenz des Spiels. Ein Spielfluss lässt sich nicht kanalisieren. Er mäandert durch die Spielzeit. Er fließt langsamer, doch in seinen Windungen und Biegungen gedeihen jene Biotope, in denen sich das Leben entfaltet.
Kreativität keimt nicht an funktional-optimierten, glatten Kanalwänden, sondern im chaotischen Urwald der Flussauen. Denn in solchen Spielräumen muss der Mensch nicht funktionieren. Hier kann er sich ausprobieren und Optionen durchspielen. Indem er spielerisch so tut als ob, lernt er an sich Facetten kennen, für die in einem funktionalen Umfeld kein Platz ist. In zweckfreien Spielen – und nirgends sonst – erschließt sich jene kostbare Ressource, der wir das eigentlich Humane unseres Menschseins schulden: der schöpferische Geist. Er bleibt der USP des Menschen. Computer werden immer besser und rechnen schneller als wir. Aber sie werden nie so unberechenbar sein. In der Unberechenbarkeit aber keimt alle Schöpferkraft. Wir sollten also ob den Szenarien des großen Triumphes von Künstlicher Intelligenz und Robotik nicht kleinlaut und ängstlich sein. Im Gegenteil. Sie sollten uns ermutigen, unseren Fokus auf das zu legen, was Menschen immer von Computern unterscheiden wird: unseren unberechenbaren Schöpfergeist. So lange ein Roboter nicht Fußball spielt wie Thomas Müller oder dichtet wie ein Hölderlin, besteht kein Grund zur Sorge um den Fortbestand der Menschlichkeit. Wenn wir jedoch den Geist des Spiels und der Kultur verkümmern lassen – wenn wir den Geist der Kreativität auf dem Altar unserer IT-Begeisterung opfern – dann ist es schlecht um uns bestellt; nicht nur um unsere persönliche Würde, sondern auch um unsere Ökonomie. Denn gerade dort wird künftig niemand mehr erfolgreich sein, der nur bestehende Prozesse optimiert und immer gerade Kanäle gräbt; sondern wer seinen Workflow so mäandern lässt, dass wirkliche Innovation erspielt wird.






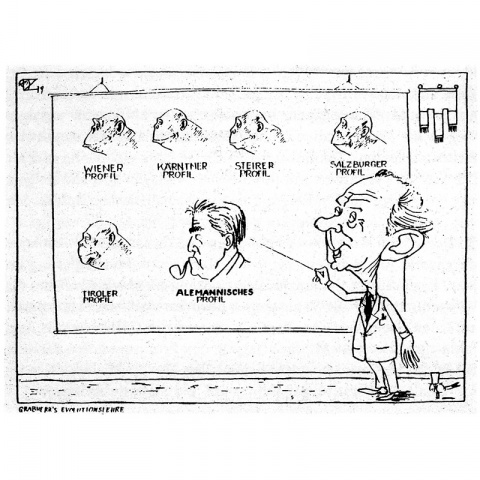



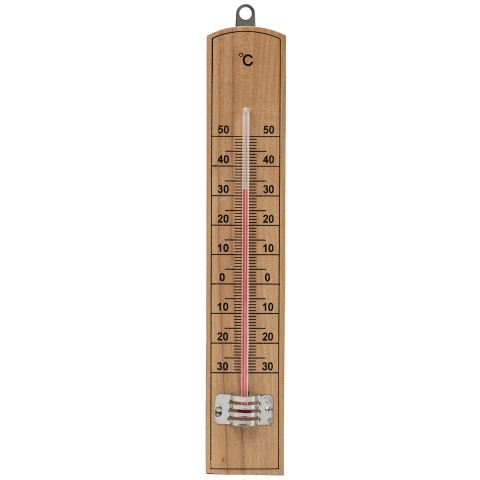

Kommentare