
Planen und Bauen in Zeiten der Nachverdichtung
Bemerkenswert: Die Vorarlberger verfolgen die Entwicklung der Preissteigerung von Bauland in den Schlagzeilen lokaler Medien, engagieren sich überparteilich für eine langfristig gesicherte Raumplanung, fordern eine Novellierung des Raumordnungsgesetzes mit neuen Planungsinstrumenten und Reglementierungen, politische Parteien proklamieren jeweils für sich „leistbares Wohnen“ schaffen zu wollen und so weiter und so fort …
Wenn die Frage um den Umgang mit Grund und Boden plötzlich im Fokus der Allgemeinheit steht und die Verteilungs- und Verwaltungsmechanismen auf derart breites Interesse stoßen, empfiehlt es sich, die Sache einmal näher zu betrachten: Roland Gnaiger sprach bei einer der mittlerweile häufig stattfindenden und gut besuchten Veranstaltungen zum Thema Raumplanung in Vorarlberg im Mai dieses Jahres von einem „Paradigmenwechsel“, der gegenwärtig in Vorarlberg stattfindet: „Das Land verwandelt sich vom Land der Eigentümer zu einem Land der Mieter“. Was hier und heute zum Vorschein kommt, ist aber nicht nur ein Paradigmenwechsel hinsichtlich der Eigentümerstruktur des Wohnraums, sondern auch ein Paradigmenwechsel in der kommunalen Planungskultur. Aufgrund des zunehmenden Nutzungs- und Bebauungsdrucks müssen sich die seinerzeit flexibel und verhandelbaren Entwicklungsabsichten der Gemeinden in allgemein gültige und verbindliche Bebauungspläne entwickeln, mit dem Ziel, die zunehmend dichter werdende Bebauung zu steuern um ein Mindestmaß an funktionaler und räumlicher Qualität der intensiver genutzten Quartiere zu gewährleisten.
Werfen wir einen differenzierten Blick auf die aktuelle Situation: Aufgrund der dramatisch gestiegenen Grundstückspreise werden wir gerade Zeuge, wie die traditionelle Wohnform des neu gebauten Einfamilienhauses zu Grabe getragen wird. Die Mittelschicht schafft gerade noch die Anschaffung einer geförderten Eigentumswohnung für die dreiköpfige Familie in einer Wohnhausanlage oder ergattert ein sanierungsbedürftiges Reihenhaus aus den 1980er-Jahren. Unbebaute Grundstücke sind rar bis gar nicht am Markt vorhanden. Den kleinen Gemeinden kommen die jüngeren Einwohner abhanden, weil günstige Kleinwohnungen eher in den Ballungsräumen zu finden sind als in den Landgemeinden.
Auf der einen Seite fordern Bauträger, Architekten und Raumplaner eine Erhöhung von Baunutzungszahlen, um die beachtlich gestiegenen Wohnpreise zu reduzieren, auf der anderen Seite verordnen Kommunen die gewohnte Baudichte mit dem Argument der Ortsüblichkeit und einer undifferenzierten Angst vor zu vielen Geschossen.
Aber zuerst zur Vorgeschichte: Grundlage der aktuellen Bewirtschaftung und Beplanung unserer Flächen bildet das Raumplanungsgesetz aus dem Jahr 1973. Dieses Gesetz entstammt der Notwendigkeit, die unkontrollierte Umwidmungspraxis der Gemeinden zur damaligen Zeit in Form eines gesetzlichen Umwidmungsverfahrens zu reglementieren und zu steuern. Es wurden Planungsinstrumente eingeführt wie der Flächenwidmungsplan, um entsprechende Widmungen auszuweisen und die zukünftige Gestaltung des Lebens-, Arbeits- und Freiraums zu ermöglichen. Die Raumplanungsabteilung wurde bei diesen Verfahren als Aufsichtsorgan bestellt, um für den notwendigen Interessensausgleich zu sorgen.
Das Vorarlberger Baugesetz war bis zur Vereinheitlichung der österreichischen Bautechnikverordnungen im Jahr 2008 die liberalste Bauordnung aller neun österreichischen Bundesländer. Liberal im Sinne einer verhältnismäßig geringen Anzahl an konkreten Bauvorschriften, aber auch liberal im Sinne der Ermächtigungen und Befugnisse aller am Bau beteiligten Personen. Die Harmonisierung der Bauvorschriften ab 2008 ist der bundesweiten und internationalen Zusammenarbeit sowie der europäischen Zielvorgabe zur Energieeinsparung geschuldet.
Dieser liberale Vorarlberger Weg, der mit vergleichsweise wenigen Bauvorschriften unter anderem das Architekturvorzeigeland Vorarlberg ermöglichte, ist zwar aus verwaltungstechnischer Sicht bemerkenswert, aus heutiger Sicht jedoch anachronistisch, da die vielfältigen Anforderungen aus Sicht des Brandschutzes, der Barrierefreiheit, der Nutzungssicherheit, des Wärme- oder des Schallschutzes nicht mehr ohne gültige Rechtsnormen abgebildet werden können.
Das Vorarlberger Raumplanungsgesetz erweist sich in diesem Aspekt als langfristiger angelegt, nimmt es doch alle erforderlichen Planungsinstrumente wie räumliche Entwicklungskonzepte und Bebauungspläne bereits vorweg. Ein Wermutstropfen dabei ist die Tatsache, dass diese Maßnahmen nicht verantwortungsvoll um- beziehungsweise eingesetzt werden. Nur so kann man verstehen, dass die Siedlungsentwicklung in Vorarlberg derart fragwürdig in Erscheinung tritt. In dieser Vermischung aus ungeregelten und unverbindlichen Bebauungsvorschriften entsteht nun das, was an vielen Orten bereits konkret ersichtlich ist: Die Verschachtelung bestehender Quartiere, vergleichbar mit suburbanen asiatischen Städten.
Angesichts der beträchtlichen Anzahl an Einfamilienhäusern auf großzügig parzellierten Grundstücken schlummert hier die private Wohnbautätigkeit der nahen Zukunft. Auf den rund 1000 Quadratmetern einer in den 1970er- oder 1980er-Jahren mit einem Einfamilienhaus bebauten Liegenschaft lässt sich bei geschickter Anordnung noch ein zweites und drittes Einfamilienhaus platzieren. Mangels leistbarer Grundstücke und der Verknappung von Bauland wohnt die junge Vorarlberger Familie dann nicht mehr im Gemeinschaftshaus, sondern im „nachverdichteten“ Gemeinschaftsgrundstück.
Problematisch an dieser Form der „nachverdichteten“ Bebauung ist die Tatsache, dass es aus kommunaler Sicht keine Bestrebungen gibt, diese Form der Bebauung in Richtung einer qualitätsvollen und zukunftsgerichteten Siedlungsstruktur zu steuern, obwohl hier mittel- bis langfristig die Quartiere jener entstehen, die den größten Anteil an der Bevölkerung stellen werden: die Generation der über 65-Jährigen (man könnte auch sagen: Diejenigen, die es sich finanziell noch leisten konnten, ein Einfamilienhaus zu errichten).
Im Sinne einer geordneten und geregelten Siedlungsentwicklung wäre es wünschenswert, die Platzierung und Höhenstaffelung von zusätzlichen Baukörpern mittels Bebauungsplänen zu steuern, einheitliche und gutproportionierte Straßenräume zu schaffen mittels Baulinien und Grenzabständen, Gehsteigbreiten oder Straßenprofile zu definieren, einheitliche Grundstückseinfriedungen zu überlegen, Durchwege und Verbindungachsen zu verordnen, aber auch erhaltenswerte Objekte oder Ensembles zu identifizieren und zu schützen – kurz zusammengefasst: Alles das, was die „städtebauliche“ Grundlagenarbeit auf Quartiersebene eigentlich ausmacht.1)
Was sind nun die Hintergründe, warum derartig regelnde und steuernde Eingriffe in bestehenden Siedlungsstrukturen erst so spät, wenn überhaupt, vorgenommen werden? Der Grund dafür ist, dass die universitäre Ausbildung bis zur Jahrhundertwende von der Doktrin des grenzenlosen Wachstums und ewig vorhandener Flächenressourcen ausging und sich Städtebau und Stadtentwicklung dementsprechend ins Umland ausdehnen sollte, wo Bauland in ausreichendem Ausmaß vorhanden war. Erst vor ungefähr zwanzig Jahren setzte in Mitteleuropa ein Umdenken ein, dass Stadtentwicklung nicht nur als Außenwachstum, sondern auch als Innenwachstum möglich ist.2) Die Nachverdichtung als eine Form des Innenwachstums stellt in unseren Breiten also erst eine relativ junge Disziplin dar und ist daher wenig akademisch etabliert und durch best-practice-Modelle erforscht und belegt.
Eine weitere Ursache für den verkrampften Zugang zur Nachverdichtung ist die undifferenzierte Abneigung vor einer zu hohen baulichen Ausnutzung, obwohl traditionelle Vorarlberger Dorfkerne eine für heutige Verhältnisse geradezu außergewöhnliche Dichte vorweisen. Helmut Tiefenthaler schreibt in seinen „Frühformen von Raumplanung in Vorarlberg“, dass sich in den frühen Agrargesellschaften eine landschaftsangepasste und landschaftsschonende Bodennutzung schon fast von selbst ergab: aus Mangel an finanzieller und maschineller Ressourcen. Diese Umstände erzwangen sehr kompakte und dichte Bebauungen, die auch sehr intensiv genutzt werden mussten.
Interessanterweise sind es diese historischen Dorfzentren, die eine beachtliche Anziehungskraft ausüben aufgrund ihrer hohen Aufenthaltsqualität und ihrer regionalen Identität und letzten Endes auch gerade deswegen allgemein sehr geschätzt werden. Ähnlich verhält es sich mit alpinen Dorfzentren, kleinteiligen Pariser Innenstadtquartieren, den Städten in der Toskana und auch vielen anderen touristischen Kulissen, die heute als Postkartenmotive dienen. Diese eben aufgezählten Beispiele verbindet ein wesentlicher Aspekt: Sie sind fußgängerorientiert und nicht automobilgerecht konzipiert. Unter der aktuellen Baugesetzgebung sind Gebäude ohne Kfz-Abstellplätze nicht baugenehmigungsfähig beziehungsweise werden diese mit einer kommunalen Ausgleichsabgabe belegt.
Aus diesen vielschichtigen Veränderungsprozessen, die mittlerweile in Vorarlberg stattfinden, wird abschließend vielleicht ersichtlich, warum die aktuell geführte Debatte um Flächennutzungen und Raumplanung derart viele Interessierte anzieht und auch zugegebenermaßen sehr leidenschaftlich geführt wird: Es sind viele Vorzeichen, die sich gegenwärtig ändern!
1) An dieser Stelle sei ein Verweis auf Georg und Dorothea Franck erlaubt, die in ihrem Buch über „Architektonische Qualität“ schreiben, dass die Beliebigkeit, die Austauschbarkeit, das Fehlen jeglicher Ordnung und Struktur als das Gegenteil räumlicher und architektonischer Qualität wahrgenommen wird.
2) Einen wesentlichen Ausgangspunkt damals spielten die schrumpfenden Städte im ehemaligen Ostdeutschland nach der deutschen Wiedervereinigung.







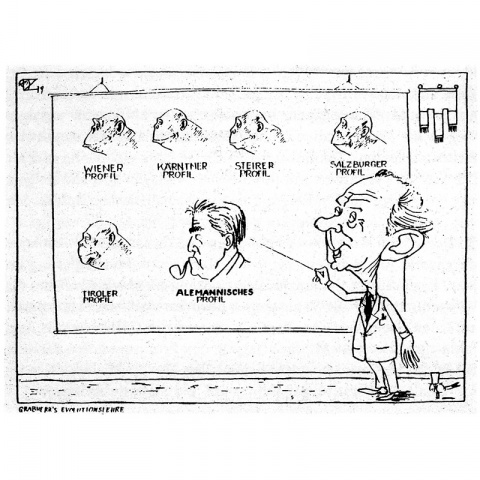



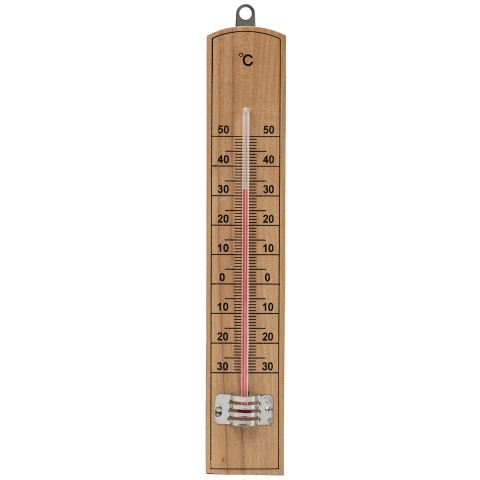

Kommentare