Politik mit aller Klarheit
Eine Floskel wurde im Wahlkampf von Vertretern aller Parteien unablässig verwendet: „Lassen Sie es mich mit aller Klarheit sagen.“ Tut mir leid, mir wurde das meiste trotz der täglich mehrfach behaupteten Klarheit noch immer nicht ganz klar.
Vielleicht, weil ich an andere als an die offenbar echt klaren und dringlichen politischen Probleme denke. Echt klar und vordringlich war auf einmal die Angleichung der Rechte der Arbeiter an die der Angestellten. Immerhin reichen die Wurzeln eines so schreienden Unrechts fast ein Jahrhundert zurück. Ähnlich vordringlich war die enorme Gefahr, die von gesichtsvermummten Araberinnen ausgehen kann. Aber ich muss einsehen: Eine Gefahr, der man ins Gesicht sieht, ist weniger gefährlich.
Persönlich hätte ich mir gerne mehr Klarheit – und mehr Sachlichkeit – in Bezug auf Probleme und Fragen gewünscht, die halt einen so kauzigen Menschen wie einen Ökonomie-Professor beschäftigen. Um einige davon herauszugreifen: Antworten darauf, wie die wachsenden Anforderungen an das Sozialsystem von der kommenden Generation der Steuerzahler finanziert werden könnten, und in welcher Höhe.
Oder: Mit welchen Maßnahmen und mit welchem Aufwand dieser Staat und seine Bürger rechnen müssen, um die weltweite Klimaerwärmung rasch zu bremsen und ihre Folgen zu mildern. Oder: Welche Position nimmt dieses Land zu den anstehenden Problemen Europas ein? Dabei geht es nicht wirklich nur um Flüchtlingspolitik, sondern etwa auch um Reformen der Wirtschafts- und Währungspolitik nach den Erfahrungen der letzten Jahre.
Natürlich ist bezaubernd, dass Herr Strolz unseren Kindern Flügel wachsen lassen will. Etwas nüchterner wäre fürs Erste für ausreichend Unterricht zu sorgen, dass sie, noch bevor sie fliegen, auch rechnen, lesen und schreiben können. Ja klar, das kostet.
Mir scheint es überfällig zu fragen, welche Bedeutung in der höheren Schulbildung den aktuellen Problemen der Menschheit endlich eingeräumt werden muss. Am Beispiel Afrikas: Die Bevölkerung dieses Kontinents wird sich von heute (1,2 Milliarden) bis 2100 fast vervierfachen (4,4 Milliarden), und das bei abnehmender Fruchtbarkeit der Böden. Österreichische Politiker würden, wenn davon überhaupt die Rede wäre, denn es spielt sich ja jenseits unserer gut gesicherten Grenzen ab, daran die Frage knüpfen: Was haben wir damit zu tun? Als Christenmenschen müssten wir aber wohl auch fragen: Was bedeutet das für die Menschen dort? Im Vergleich damit scheinen mir die Punischen Kriege doch schon etwas entlegener. Von der aktuellen Problematik Afrikas bekamen meine Kinder im Laufe ihrer Gymnasialkarriere (fast) nichts zu hören. Hannibal hingegen lief ihnen gleich drei Mal mit seinen Elefanten über den Weg.
Auch wenn manche Politiker die Verbesserung der Konjunktur in den letzten Monaten mit ihrem Wirken in Zusammenhang bringen wollten, wird die neue Regierung gut beraten sein, nicht zu glauben, da sei nichts mehr nötig, sondern die anstehenden Probleme des Landes ernst zu nehmen. Die Perspektiven des 21. Jahrhunderts – Umwelt, Technologie, Alterung, Demokratie, Fairness – gehen tiefer als ein Konjunkturaufschwung trägt.
Sie erfordern ein grundlegendes Überdenken der Möglichkeiten, Ziele und Wertvorstellungen. Weitsichtige Reformen stehen an. Dass sich Politiker im Wahlkampf scheuen, konkrete Adressen, an denen sich Reformen auswirken könnten, anzugeben, dafür kann man ein gewisses Verständnis aufbringen. Es ist aber falsch davon auszugehen, dass alle Reformen Gewinner und Verlierer kennen. Es gibt nicht selten Win-Win-Situationen; freilich meist nicht auf kurze Sicht, nur muss man dafür Weitblick, Geduld und Konsequenz aufbringen.
Wenig Verständnis verdienen Oberflächlichkeit und populistische Banalitäten. Es ist strafbar, oberflächlich zu behaupten, das Pensionssystem bedürfe keiner Reformen, nicht einmal auf lange Sicht. Begründung: Der für das laufende Jahr im Budget veranschlagte Bedarf an Zuschuss aus dem allgemeinen Steuertopf werde bereits unterboten. Auch sei der steigende Bedarf bis zum Jahr 2060 gesichert, weil sich auf sehr lange Sicht nur ein mäßig steigender Aufwand ergibt. Das will suggerieren, dass der Anstieg daher auch bis 2030 mäßig steil und mühelos zu bewältigen ist – ein politischer Taschenspielertrick. Ist er nämlich nicht, weil der Mehrbedarf zum Großteil schon bis dahin fällig wird: In einem Zeitraum von nicht viel mehr als einem Jahrzehnt steigt er damit aber mehr als doppelt so schnell. Was kümmert Politiker ein Problem des Jahres 2030, wenn sie sich gerade auf 2060 konzentrieren?
Die Diskussion über unvermeidlich steigenden Sozialaufwand anhand der angeblich gesicherten Pensionen sieht häufig davon ab, dass der Bedarf an Gesundheits- und Pflegeleistungen einer älter werdenden Bevölkerung gleichzeitig steigt. Damit gelangen wir in das allseits beliebte Thema Staatsreform und Föderalismus. Aus Wiener Sicht gebietet zwingende Logik, durch zentralistische Reformen so und so viele Landtagssitze und Dienstwagen einzusparen. Länder und Landtage versteifen sich auf ihre Positionen nur, um ihre politische Macht zu erhalten.
Gerade, wem Föderalismus aus vielen Gründen ein Wert und ein Anliegen ist, kann nicht fordern, an den gegenwärtigen Formen und der politischen Praxis Österreichs in Bezug auf Föderalismus dürfe nichts geändert werden. Tatsächlich gibt es Reformbedarf. Das Prinzip der Subsidiarität verspricht, richtig definiert und umgesetzt, Effizienz, Innovation und Bürgernähe. Halbherzig und inkonsequent konstruiert, kann es auch als Vorwand für überhöhte Kosten, Provinzialität und Klientelpolitik missbraucht werden. Für beides finden sich in Österreich Beispiele.
Das erinnert an die Debatte über Formen der Sozialpartnerschaft, die gleichzeitig auch wieder auf die politische Tagesordnung getragen wurde. Nicht selten hört man, der Erfolg Österreichs und seiner Wirtschaft über mehr als ein halbes Jahrhundert hinweg sei zwei Säulen zu verdanken: der Neutralität und der Sozialpartnerschaft. Natürlich ist das banaler Quatsch.
Die Verhältnisse sind in Wirklichkeit weit komplexer, und sie haben nicht nur mit Verfassung und Statuten zu tun, sondern auch mit Persönlichkeiten. Auch für einen Professor gehört es zu den gültigen Weisheiten, wie es ein schon lange verstorbener Präsident einer Kammer einmal formuliert hat: „Gute Sozialpartnerschaft ist für ein Land gut, schlechte ist für ein Land schlecht.“ Das ist alles andere als banal. Hier beginnt die große politische Kunst. Möge die neue Regierung dies richtig verstehen.







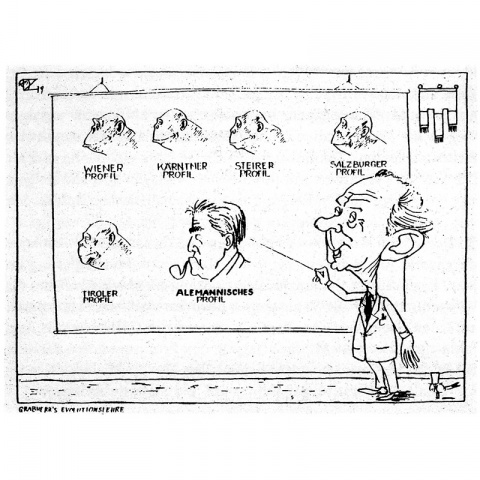



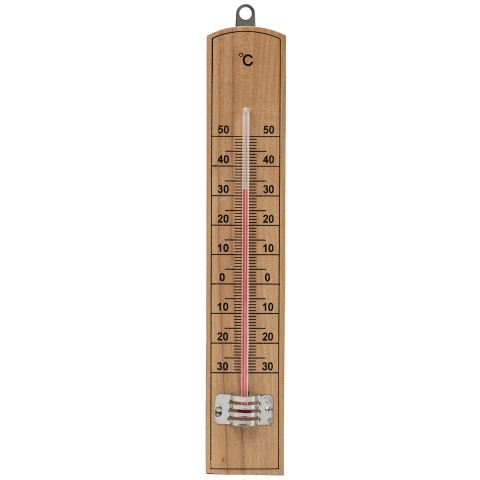

Kommentare