
Warum die direkte Demokratie Filter braucht
Regula Stämpfli plädiert im „Thema Vorarlberg“-Gespräch für das wichtige Initiativrecht und warnt davor, direkte Demokratie nur für die „Verhinderung des Schlimmsten“ heranzuziehen. Ferdinand Karlhofer entkräftet Tocquevilles Theorie von der „Tyrannei der Mehrheit“ und erklärt, warum Österreich „weit weg“ von der Schweizer Kultur der direkten Demokratie ist.
In kaum einem anderen Land können die Menschen neben regulären Wahlen auch durch Volksabstimmungen in einem so hohen Maß an politischen Entscheidungen partizipieren wie in der Schweiz. „Die direkte Demokratie bringt Themen in den politischen Entscheidungsprozess, die institutionell kaum Erwähnung finden“, nennt Regula Stämpfli, Schweizer Historikerin und Politikwissenschaftlerin, den größten Gewinn einer ausgeprägten direkten Demokratie, wie sie in unserem Nachbarland praktiziert wird. Auch aus diesem Grund hat Stämpfli selbst die Europäische Bürgerinitiative in Brüssel mitlanciert, „damit die EU-Kommission sich mit Themen befassen muss, die sie partout unter den Tisch kehren will“. In der Schweiz habe das indessen gut funktioniert, sagt Stämpfli: „Gentech-Moratorium, Quotendiskussion und Managerlöhne – alles Vorschläge, die dank dem Instrument der direkten Demokratie zustande gekommen sind.“ Kritiker dieses Systems argumentieren, dass sich in vielen Abstimmungen der Populismus gegen handfeste Argumente durchsetzt. Ferdinand Karlhofer, Leiter des Instituts für Politikwissenschaft an der Universität Innsbruck, analysiert: „Die Schweizer haben mit ihrer im europäischen Vergleich einzigartigen direkten Demokratie auch viele Filter eingebaut.“
Direkte Demokratie – nicht nur um das Schlimmste zu verhindern
Das schütze nicht generell vor Populismus, „aber trotzdem: Die Schweiz hat fixe Termine für ihre Referenden – in der Regel vier pro Jahr – und üblicherweise wird über mehrere Themen abgestimmt. Es ist nur so, dass unsere Aufmerksamkeit immer auf dem eklatantesten Thema liegt.“ Dazu gehören in jüngerer Vergangenheit jene über eine zusätzliche Urlaubswoche, Managergehälter und die sogenannte Durchsetzungsinitiative. Mit Letzterer wollte die Schweizerische Volkspartei (SVP) in der Verfassung festschreiben, dass Ausländer auch bei geringfügigen Vergehen automatisch abgeschoben werden müssen – ohne Einzelfallprüfung und ohne Ermessensspielraum für einen Richter. Die Schweizer lehnten das ab – was in Zeiten aufgeheizter Diskussionen um Migrations- und Fluchtbewegungen durchaus überraschte. „Unsere Nachbarn haben schon ein Minarett- und Ausschaffungsreferendum hinter sich. Beide richteten sich eindeutig gegen Zuwanderung und haben entsprechende Zustimmung erhalten. Mit der Durchsetzungsinitiative wollte die SVP noch eines draufsetzen – weil aber ohnehin schon alles ausgereizt war, hat diese Initiative keine Zustimmung mehr gefunden“, wagt Ferdinand Karlhofer eine Erklärung. Seine Schweizer Kollegin Stämpfli ergänzt: „Hier gewann eine junge Generation und eine Hyperlink-affine Wählerschaft gegen die SVP und die Holzmedien; damit sind die klassischen Leitmedien gemeint, die in Umfragen den Sieg der SVP regelrecht herbeischrieben. Es war großartig, zu sehen, wie eine Initiative, von der alle Parteien und Beobachter behaupteten, sie käme auf jeden Fall durch, von engagierten Frauen und Männern via Netz bezwungen wurde.“ Stämpfli hofft, dass dieser Elan, sich für Demokratie, Vielfalt und die Menschen einzusetzen, auch in Zukunft bleibt und nicht „nur für die Verhinderung des Schlimmsten zum Blühen kommt“.
Die Frage nach der Herrschaft der Mehrheit
Charles Alexis Henri Maurice Clérel de Tocqueville, französischer Publizist, Politiker und Historiker, sprach einst von der „Tyrannei der Mehrheit“. Regula Stämpfli stellt klar: „Die direkte Demokratie ist großartig, aber sie braucht eine Grenze in der Verfassung. Wer die Menschen- und Grundrechte im Namen der direkten Demokratie abschaffen will, macht eine Ermächtigungsdemokratie, die direkt zur Volksdiktatur führt. Also: Hände weg!“ Für sie gilt der Grundsatz: Alles darf zur Abstimmung kommen, sofern es die in der Verfassung vorgesehene Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz nicht tangiert. Ferdinand Karlhofer geht in diesem Zusammenhang auf die eingangs erwähnten Filter ein, welche unsere Nachbarn zum Schutz von Minderheiten eingebaut haben, der den Schweizer Föderalismus im Allgemeinen auszeichne: „Es braucht zum Beispiel immer ein sogenanntes doppeltes Mehr – das heißt, die Mehrheit der Gesamtbevölkerung und die Mehrheit der Kantone. So wird einer Herrschaft der Mehrheit vorgebeugt.“
Direkte Demokratie ist keine Patentlösung
Taugt nun das Schweizer Modell mit der ausgeprägten direkten Demokratie als Vorbild? Regula Stämpfli ist skeptisch: „Die Schweiz als ‚Die Schweiz‘ ist nie ein Modell. Aber gewisse politische Instrumente taugen und andere nicht. Und ja: Das Initiativrecht würde ich immer und gegen alle verteidigen und als guten Schritt in die richtige Richtung loben.“ Der Leiter des Instituts für Politikwissenschaft gibt in Hinblick auf Österreich eine weitere Dimension der Debatte zu bedenken: „Eine differenzierte Betrachtung ist essenziell: Nur die direkte Demokratie auszubauen, ohne zu überlegen, wie das politische System aussieht, bringt nichts.“ In der Schweiz könne man von einer Entscheidungspyramide in politischen Prozessen sprechen, die aber keine Entscheidungsspitze im klassischen Sinne vorweise, erklärt Karlhofer weiter und führt aus: „Da ist klar, dass es eine weitere Autorität geben muss – das ist das Volk als Souverän, das schon von der Verfassung her dieses Recht in Anspruch nehmen kann.“ Vergleichbare Erfahrungen würden in Österreich allerdings fehlen – „hier gibt es keine entwickelte Kultur im Umgang mit direkter Demokratie. Von der Schweiz, wo die direkte Demokratie ein ständig praktiziertes Mittel der politischen Willensbildung ist, sind wir weit weg“, so Karlhofers Fazit.






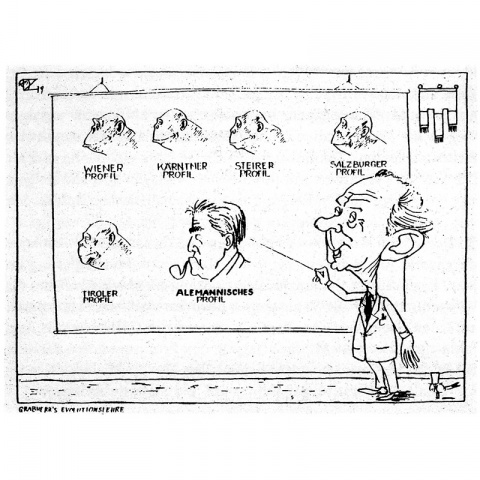



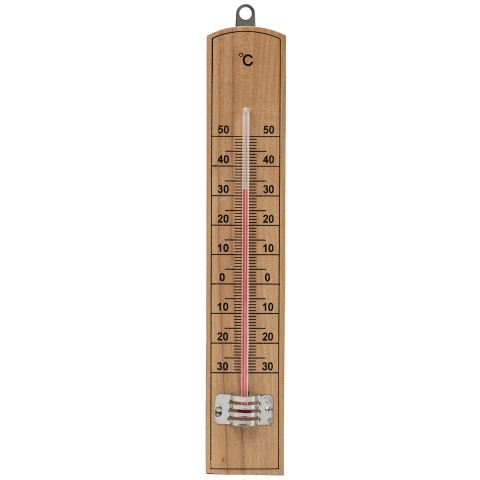

Kommentare