Europapolitik ist Innenpolitik
Man kann das durchaus positiv sehen: Als einige Tage vor der Wahl die österreichischen Parteiführer („Elefanten“) vor großem Fernsehpublikum ihre wichtigsten politischen Schwerpunkte erläuterten, kam das Thema Europa nicht vor. Es ist zu begrüßen, dass sie von Aufgaben sprachen, denen „wir“ uns in Österreich widmen sollten und die wir nicht einfach nach „Brüssel“ abschieben können: Bildungsreform, Sozialstaat sichern, Vollbeschäftigung, Integration von Ausländern. Überwiegend Hausaufgaben. Nur gerade Frau Lunacek nannte die Klimakrise als dringendstes Problem, eines von globaler, nicht nur von europäischer Dimension.
In Wirklichkeit haben aber alle diese Aufgaben Dimensionen, die weit über die nationalen Grenzen hinausreichen. Nur der Versuch des bisherigen Bundeskanzlers, den gerade in Gang gekommenen konjunkturellen Aufschwung so darzustellen, dass er etwas mit der österreichischen Wirtschaftspolitik zu tun haben könnte, war da doch etwas verwegen und hat ihm auch nichts gebracht.
Wenn nicht die österreichische Wirtschaft sich ständig bewusst wäre, dass sie sich in einem internationalen, jedenfalls europäischen Rahmen behaupten muss: Die österreichische Politik ihrerseits fühlt sich gewöhnlich nicht berufen, über Europa nachzudenken und Problemlösungen zu entwickeln, die nicht nur unseren nationalen Interessen, sondern auch denen der Nachbarn und Partner entsprechen würden. Der eigene Schrebergarten wird sorgfältig gepflegt. Der des Nachbarn geht uns nichts an: „Lasst uns in Ruhe damit, wir lassen euch ja auch in Ruhe.“ Nur hilft halt ein gepflegter Gartenzaun wenig, wenn das Hochwasser überall steigt.
Das europäische Modell steht schwer unter Druck: Es geht nicht um österreichische Antworten auf „America first“. Weder das Weiße Haus noch der Kreml fragen danach. Aber wenn Europa einigermaßen geschlossen und klar seine Position signalisiert, hat es eine Chance, nicht übersehen und nicht übergangen zu werden. Das europäische Modell: gleichzeitig Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaat, soziale Sicherheit und Solidarität mit Bedürftigen. Voraussetzung dafür: Marktwirtschaft und fairer Wettbewerb, und, weil leider wieder aktuell, ein ausreichender Beitrag zur internationalen Sicherheit, auch der militärischen.
Das Konzept Europas – eine der wirtschaftlich größten Mächte der Erde als „soft power“–, das von der Unterstützung der eigenen Bevölkerung getragen wird und sich von anderen Systemen vorteilhaft unterscheidet, darf nicht durch Kurzsichtigkeit und Nationalismus aufs Spiel gesetzt werden. Das hat in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts zu einer beispiellosen Katastrophe geführt.
Einer der bizarrsten Momente im zurückliegenden Wahlkampf war erreicht, als in der Fernsehdebatte zwischen den Herren Kurz und Strache ein Streit darüber ausbrach, wer von den beiden die engeren Kontakte zu Viktor Orban unterhalte; zu jenem ungarischen Regierungschef, dem die Grundlagen der Europäischen Union so herzlich egal sind wie leider auch der polnischen Regierung oder wie dem britischen Außenminister Boris Johnson die Folgen des Brexit für Europa und für sein eigenes Land.
Das alles soll auf keinen Fall heißen, dass in der EU alles, vom Grundsätzlichen bis zum Alltäglichen, in Ordnung ist. Wirklich nicht – gerade weil sich Wirtschaft und Gesellschaft in einem epochalen Umbruch befinden, treffen Interessengegensätze hart aufeinander: Braunkohle, Ölkonzerne, Automobile, Flugzeuge, die für das Schlucken von Kerosin subventioniert werden, Weltunternehmen mit Schwerpunkt digitale Technologien, die wie durch Zauber Milliardengewinne zum Verschwinden bringen, auch wenn der Fiskus zuschaut, oder ein System der internationalen Hochfinanz, das sich gegen eine griffigere Aufsicht der EU und gegen Beteiligung am Risiko hartnäckig und wirkungsvoll wehrt.
Dieses Plädoyer für aktive und engagierte Teilnahme an der Europäischen Union klammert das Beispiel „Schweiz“ aus. Die Schweiz, die gewiss auch ihre Probleme hat und lösen muss, kommt auch ohne Mitgliedschaft ganz gut zurecht. Warum also nicht eine Europapolitik „nach Schweizer Vorbild“, wie das der österreichischen Neutralität vorgegeben war (oder ist)? Vier Argumente: Das Schweizer Volk hat seit Mitte des 19. Jahrhunderts eine Kultur der Bündnisfreiheit, der direkten Demokratie und der politischen Selbstverantwortung jedes Einzelnen entwickelt, das in anderen Gegenden Europas, einschließlich Österreich und Deutschland, nicht funktionieren könnte. Sagen wir: aus Mangel an entsprechender Erfahrung, oder eben auch, aus unterschiedlichem Naturell. Die Schweizer Wirtschaft war bei der Entscheidung über „Europa“ in den 1990er-Jahren ungleich stärker in die internationalen Märkte integriert als damals Österreich. Daher war sie durch allfällige Diskriminierung als Außenseiter weniger gefährdet. Drittens: Die Schweiz muss die EU-Gesetzgebung weitgehend „autonom nachvollziehen“, hat aber bei der Beschlussfassung in Brüssel kein Mitspracherecht. Ein arger – formeller? – Schönheitsfehler. Viertens: Die Probleme, mit denen die EU kämpft – Immigration, weltwirtschaftliche Verlagerungen, Terrorismus, Turbulenzen im Währungssystem – zeigen sich in der Schweiz ganz ähnlich, teilweise noch schärfer.
Das Plädoyer für ein aktiveres Mitwirken der österreichischen Politik an der Gestaltung Europas bedeutet nicht, dass die Hausaufgaben so lange warten könnten, bis sie von der EU gelöst worden sind. Aber es verwundert doch, dass, relativ knapp bevor Österreich routinemäßig für ein halbes Jahr den Ratsvorsitz in der EU übernimmt, die Dimension „Europa“ den Spitzen der Parlamentsparteien keiner Bemerkung wert schien. Außer der grünen Spitzenkandidatin – und die wurde von den Wählern dafür bestraft.
Wir haben uns zu sehr an die Vorzüge eines gemeinsamen Europa gewöhnt, dass uns nur auffällt, wenn manches nicht so gut funktioniert. Besonders gilt das für die jüngere Generation. Als ich in Bregenz aufwuchs, bemerkte manchmal mein Vater selig: „Büeble, des möcht‘ i no erleaba, dass ma wieder ohne Pass mit dem Schiff ga Linda fahra ka.“ Das hat er nicht mehr erlebt.







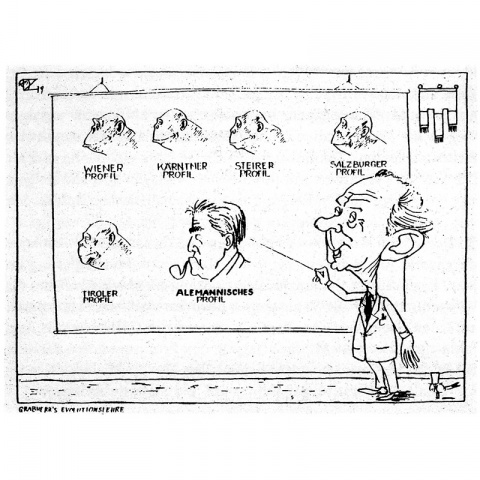



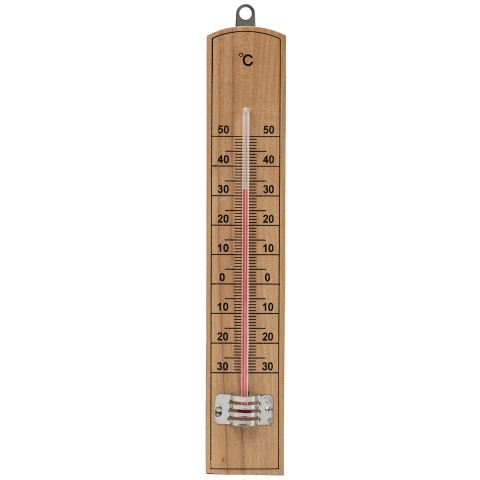

Kommentare