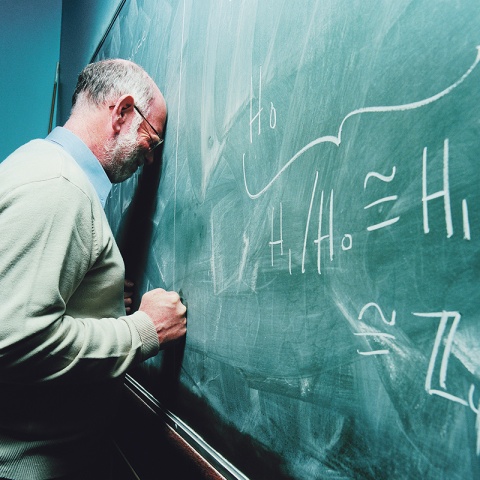
Mit Vollkasko gegen die Wand
Endlich wurde korrigiert, was zwar erst vor acht Jahren eingeführt wurde, aber dennoch überfällig war. Damals war die Lehrerausbildung von fünf auf sechs Jahre verlängert worden. Nun soll das Studium für die Primarstufe (Volksschule) und die Sekundarstufe (AHS, BHS, Mittelschule) aus drei statt vier Jahren Bachelor- und zwei Jahren Masterausbildung bestehen. Unter anderem damit will Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) dem immer größer werdenden Personalmangel entgegenwirken. Ein Schelm, wer dabei denkt, dass man von dieser Entwicklung auch schon vor acht Jahren hätte wissen können.
Es dauert nicht lange, da findet der Minister Post in Form eines offenen Briefes in seinem ministerialen Briefkasten. Absender: eine Gruppe Vorarlberger Lehramtsstudenten. Inhalt: Auch wenn man die Korrektur nach acht Jahren grundsätzlich für die kommenden Jahrgänge begrüße, so sei es dennoch hochgradig ungerecht für ihre „Generation“ und dafür wollen sie vom Steuerzahler entschädigt werden: „Dieses eine zusätzliche Jahr, das wir durchlaufen, muss unserer Meinung nach in irgendeiner Form kompensiert oder abgegolten werden.“ Die längere Studiendauer habe finanzielle und berufliche Nachteile für die betroffenen Jahrgänge, etwa durch den Verlust eines Jahresgehaltes und der fehlenden Pensionsanrechnung. „Garniert“ wird der Brief mit dem Vorwurf zu geringer Wertschätzung für den Beruf und dem Wunsch nach einer Debatte über die gesellschaftliche Anerkennung der Lehrerausbildung in Österreich. Und wenn man schon einmal bei der Zeitung ist, wird der Journalistin noch in den Block diktiert, dass das Bildungssystem derzeit sowieso auf der Intensivstation liege.
Ob der offene Brief zur schnellen Genesung und zur Verlegung in die Normalstation und dem Wunsch nach einer höheren Wertschätzung wirklich hilft? Könnte schwierig werden. Noch nicht zu Ende studiert (in Österreich immer noch praktisch gratis), noch nie im erlernten Beruf gearbeitet, aber bereits die erste Entschädigung vom Staat fordernd und noch vor der ersten gehaltenen Unterrichtsstunde damit hadernd, dass man auf einer Intensivstation arbeiten muss. Findet das wirklich jemand ausserhalb dieser Gruppe gut?
Mit ziemlicher Sicherheit ja. Schon gar nicht ist auszuschliessen, dass die Politik dem Begehr der angehenden Pädagogen Gehör schenken könnte. Spätestens seit Corona ist in Österreich die Gießkanne das meistgenützte politische Instrument. „Darfs ein bisschen mehr sein und das für alle?“ Ein bisschen mehr Covid-Hilfe, ein bisschen mehr Klimabonus, ein bisschen mehr Förderung oder Mehrwertsteuerbefreiung für die Photovoltaik-Anlage, die man vor allem deshalb anschafft, weil sie sich – auch ohne Förderung – schlicht rechnet. Gerne zum Drüberstreuen und ebenfalls zum größten Teil auf Steuerzahlerkosten eine neue Heizung für zu Hause, das Gratis-Klimaticket für Bus und Bahn für alle 18-Jährigen oder – zumindest für die auswärts Studierenden – zur Hälfte von vielen Standortgemeinden finanziert. Das nennt man dann wohl „schlau“, weil damit die Studiosi den Hauptwohnsitz in ihrer Gemeinde belassen, wofür die Kommunen aus einem anderen Fördertopf deutlich mehr Geld erhalten, als sie den Studenten mit auf den Weg geben.
Und zum Drüberstreuen wirft der Kanzler in seiner Rede zur Nation noch einen quasi „Nehammer-Tausender“ unters Volk, weil man in dessen Augen wohl nur dann kein fauler Hund ist, wenn man 100 Prozent arbeitet. Eh schon wurscht bei 33 Milliarden an Förderungen, die der Staat jährlich ausgibt. Damit beträgt Österreichs Förderquote 7,5 Prozent und ist damit längst deutlich höher als im EU-Schnitt (6,7 Prozent).
Und noch etwas wurden wir in den vergangenen Jahren gelehrt. Auch bei der Auswahl der Förderungs-Adressaten ist man nicht zimperlich. Wer reibt sich nicht die Augen, wenn er hört, dass Milliarden-Pleitier René Benko für sein 6-Sterne-Chalet „N“ in Oberlech 1,2 Millionen an Covid-Förderungen erhalten hat, wie auch alle russischen Oligarchen, die sich meist über zypriotische Briefkastenfirmen Hotels – oder sind es doch keine – in den Winter-Hotspots unter den Nagel gerissen haben. Auch sie sollen in Zukunft, geht es nach dem fürsorglichen Staat, zumindest einmal am Tag warm essen können.
Über den erwähnten „Nehammer-Tausender“ kann sich weder jemand, der neben der Erziehung von Kindern oder der Pflege der Eltern „nur“ 80 Prozent arbeitet als auch ich mich als altmodisch Vollzeit arbeitender Grenzgänger nicht freuen. Den schweizerischen „Karin Keller-Sutter-Tausender“ gibt es nämlich nicht. Die Bundesrätin und Vorsteherin des Eidgenössischen Finanzdepartements hat derzeit ganz andere Sorgen. Am 3. März, also kurz nach dem Erscheinen dieser Ausgabe, stimmt das Schweizer Volk über eine zusätzliche 13. AHV-Rente (Alters- und Hinterlassenschaftsversicherung) ab. Die Initianten fordern gleichzeitig, dass sichergestellt werden müsse, dass Menschen, die Ergänzungsleistungen bekommen – also den wirklich Bedürftigen – diese nicht gekürzt werden. Wie gegenfinanziert werden soll, lassen die Initianten offen.
Karin Keller-Sutter von der freisinnigen FDP wehrt sich mit Händen und Füßen gegen die zusätzliche Rente für 2,6 Millionen Pensionierte, obwohl die AHV bis zumindest 2030 nicht defizitär ist. Das wurde durch verschiedene Reformen, etwa durch die vom Volk 2022 abgesegnete schrittweise Anhebung des Pensionsalters für Frauen auf 65 Jahre, sichergestellt. Die noch bestehende finanzielle Balance sieht Keller-Sutter massiv gefährdet, weil die Umsetzung der Initiative schon im ersten Jahr 8,7 Prozent oder 4,1 Milliarden Franken mehr kosten würde. Ein Szenario, das bei österreichischen Politikern nur ein müdes Lächeln auslöst. Obwohl die Zuschüsse zu den Pensionen inzwischen beinahe ein Viertel des Gesamtbudgets ausmachen, hat man auch hier schnell wieder die Gießkanne ausgepackt. 9,7 Prozent mehr für (fast) alle. Hätte man das „förderungs-verwöhnte“ Volk gefragt, es wäre nichts anderes herausgekommen. Wie die Schweizer am 3. März entscheiden, war – gemäß den jüngsten Umfragen – noch offen.







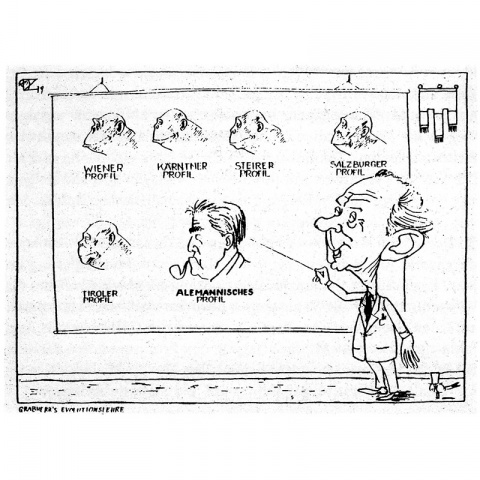



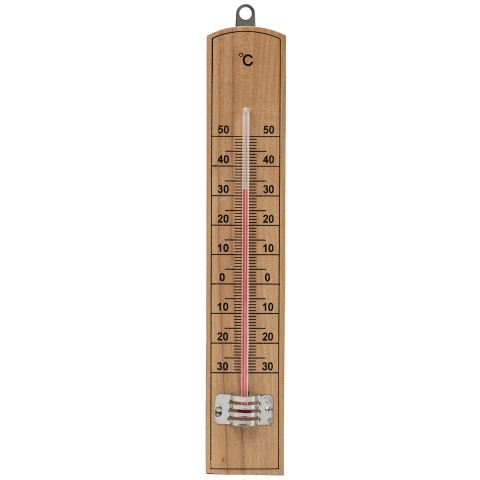

Kommentare