
Brutal ist der Kampf ums Überleben
Nur der Mensch tötet zum Zeitvertreib, sagt man, in der Natur hingegen herrschen Eintracht und Harmonie. Tiere töten aus Notwendigkeit, aus dem reinen Drang zu überleben. Wer jemals beobachtet hat, wie eine vollgefressene Katze mit einer Maus spielt, wird sich rasch von diesem naiven Vorurteil trennen. Geht es auch tatsächlich um Nahrungserwerb (sei es für das Tier selbst, sei es für seinen noch ungeborenen Nachwuchs), so erscheinen uns manche Praktiken doch mehr als brutal.
Wie Noah auf seiner Arche verhindern konnte, dass all die Tiere gegenseitig übereinander herfielen, wird ein Mysterium bleiben. Vielleicht hat ja Gott doch noch ein Einsehen gehabt und für die Dauer der Kreuzfahrt jene paradiesischen Zustände wiederhergestellt, als alle Tiere Vegetarier waren. Doch danach besann Gott sich darauf zurück, dass er gleichzeitig zur Vertreibung von Adam und Eva nicht nur die Schlange verflucht, sondern auch die gesamte Tierwelt pauschal mit bestraft hatte. Und das große Fressen, der tägliche Kampf ums Überleben begann aufs Neue.
Die Schlange hält sich nicht an den göttlichen Fluch. Muss sie auch auf ihrem Bauche kriechen, so ist sie nicht sonderlich darauf erpicht, ihr Lebtag lang – wie von Gott befohlen – Staub zu fressen. Kröten munden ihr besser. Es ist ein beeindruckendes Schauspiel, wenn eine Ringelnatter eine Erdkröte zu verschlingen versucht, ist doch eine ausgewachsene Kröte um ein Vielfaches dicker als ihr Gegner. Aber Maul und Körper der Schlange sind dehnbar, und ihren Unterkiefer kann sie aushängen. Nicht immer ist der Versuch von Erfolg gekrönt: Die Kröte bläht sich auf, sie macht sich so noch ein wenig dicker. Manchmal lässt die Natter – oft erst nach stundenlangem Würgen – von ihr ab. Ist aber die Schlange erfolgreich, so wird Kröte bei lebendigem Leib verschluckt und danach bei lebendigem Leib verdaut. Das Opfer beim Verschlingen auch gleich zu töten, hat die Natur in diesem Falle nicht vorgesehen.
Der Kampf ums Überleben ist derart alltäglich, dass wir ihn gar nicht mehr wahrnehmen, selbst wenn er sich direkt vor unseren Augen abspielt. Wir ärgern uns vielleicht über die Spinnweben in unzugänglichen Winkeln im Haus, aber wir lassen die Spinnen gewähren, solange sie uns vor surrenden Plagegeistern bewahren. Da nimmt man gerne die Ansammlungen unverdaulicher Chitinreste der Insektenpanzer in Kauf. Ist im Haus auch der Staubsauer der größte Feind der Spinnen, so sind sie draußen anderen Gefahren ausgesetzt. Vögel stellen ihnen nach, und auf freien, keinen Schutz bietenden Flächen können sie leicht im Schnabel und Magen einer Bachstelze landen. Aber nicht immer ist der Magen des Feinds ihre letzte Ruhestätte. Gar nicht wenige Insekten nutzen Spinnen, aber auch andere Gliedertiere und deren Larven als Fresspakete für ihren Nachwuchs.
Die Orientalische Mörtelwespe zählt eigentlich zu den Grabwespen. Graben tut sie freilich nicht, und auch bereits vorhandene Röhrchen verschmäht sie. Aus Lehm baut sie tönnchenförmige Brutzellen, und dies zum Schutz vor Regen und Nässe bevorzugt innerhalb menschlicher Behausungen. Jede Brutzelle wird anschließend mit 8 bis 25 kleinen bis mittelgroßen Spinnen befüllt. Im Zick-Zack-Flug sucht die Wespe nach einem geeigneten Opfer, das sie nach einem Blitzangriff mit einer Giftinjektion lähmt. Das Gift reduziert gleichzeitig Kreislauf und Stoffwechsel der Spinne, tötet sie aber nicht. Das Opfer soll bei geringem Sauerstoffverbrauch möglichst lange am Leben erhalten werden, um der Wespenlarve als frische Nahrung zu dienen – vom Beginn der Lähmung bis zum Fraß durch die Made kann fast ein Monat vergehen. Bereits an der ersten eingetragenen und damit am Grund der Lehmzelle liegenden Spinne befestigt die Mörtelwespe ein einziges Ei. Ist das Tönnchen mit genügend Nahrungsvorrat gefüllt, so wird es mit einem Deckel verschlossen. Schon drei bis fünf Stunden danach schlüpft die Larve. Sie beißt an der Bauchseite der Spinne eine Öffnung in deren Hinterkörper und saugt ihr Opfer aus. Die Spinne bleibt dabei weiterhin nur betäubt. Sie stirbt erst, wenn sie unter das Existenzminimum verzehrt ist. Nach drei Larvenstadien verpuppt sich der Mörtelwespen-Nachwuchs schließlich innerhalb einer rotbraunen, durchscheinenden Membran. Zu diesem Zeitpunkt sind endgültig alle Fresspakete aufgebraucht.
Parasitismus dieser Art ist gar nicht so selten, und keine Kleintiergruppe ist davor gefeit. Etwa ein Zehntel der bisher bekannten Insektenarten führt eine parasitoide Lebensweise. Unter ihnen sind rund drei Viertel Hautflügler, gefolgt von den Fliegen mit 20 Prozent. Der Rest verteilt sich auf andere Insekten-Ordnungen. Während bei den Hautflüglern immer Gliedertiere als Wirte dienen, können die Fliegen auch Strudelwürmer, Schnecken, Regenwürmer und Amphibien befallen. Allen Parasitoiden gemeinsam ist, dass sie in ihrer Entwicklung parasitisch leben und ihren Wirt dabei töten. Manchmal sind auch die Nahrungsvorräte, die andere Tiere ihrem Nachwuchs mitgegeben haben, das erste, unmittelbare Ziel – mit dem Nebeneffekt, dass das Opfer verhungert (und nach Aufbrauch der Vorräte nun ebenfalls als Nahrung dienen kann). Und manche Parasitoide werden ihrerseits wieder parasitiert – die Abläufe können sehr komplex sein. Fressen schützt nicht davor, selbst gefressen zu werden.
Für uns Menschen erscheint es brutal, bei lebendigem Leibe ausgesaugt oder verdaut zu werden. Im Tierreich ist dies ein Mittel, die Bestände einzelner Arten in einem kontrollierbaren Rahmen zu halten. Eine Welt, in der ausschließlich pflanzenfressende Tiere sich unkontrolliert vermehren, wäre dem Untergang geweiht.

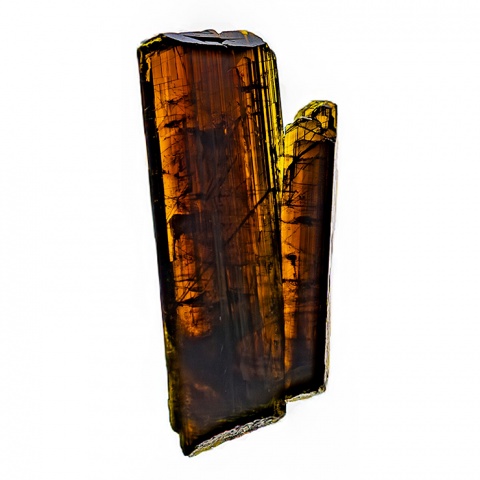









Kommentare