

inatura goes „Camping“
Die Biologie als Wissenschaft geht merkwürdige Wege. Genetik heißt das Zauberwort. Vor einigen Jahren haben wir noch darüber gewitzelt, dass es wohl bald ein Kästchen zur Analyse von Fledermauskot geben wird: Man wirft oben etwas Kot hinein, das Gerät erklärt uns nach wenigen Minuten nicht nur, von welcher Fledermausart die Hinterlassenschaften stammen, sondern auch, was das Tier gefressen hat. Heute ist dies beinahe Realität. Für den Geländeeinsatz ist die Analyse zwar etwas zu aufwändig, aber im Labor liefert die Arterkennung auf Basis des genetischen Codes sehr gute Ergebnisse – auch bei Mischproben, wie eben Fledermauskot. Auf der Strecke bleibt dabei die organismische Biologie, speziell das Erkennen und Unterscheiden von Arten mit konventionellen Methoden. Ist eine biologische Art auch definiert als Fortpflanzungsgemeinschaft, so bewegen wir uns bei der Artbestimmung immer noch auf demselben Niveau wie Carl von Linné um die Mitte des 18. Jahrhunderts: Wir orientieren uns am Aussehen des Tieres, nur in zweifelhaften Fällen werden auch die Geschlechtsorgane betrachtet. Die Genetik liefert uns lediglich weitere Hinweise, um kaum unterscheidbare Zwillingsarten zu trennen.
Wollen wir aber ein unbekanntes Tier anhand seines artspezifischen genetischen Codes identifizieren, so muss eine Vergleichsdatenbank den Code eines sicher bestimmten Exemplars derselben Art enthalten. Und damit beginnt die Schwierigkeit. Bei attraktiven Tiergruppen – wie den Schmetterlingen – gibt es genügend Experten, die sich zum Ziel gesetzt haben, eine umfassende Gen- Datenbank aufzubauen, die möglichst alle bekannten Arten berücksichtigt. Ihr Wissen ermöglicht es ihnen, die Tiere auf Basis von Aussehen und Geschlechtsorganen eindeutig zu bestimmen, um sie danach genetisch zu klassifizieren. Weniger attraktive Gruppen hingegen sind Stiefkinder der Forschung. Unter den Zweiflüglern erlangen nur die Schwebfliegen, Bremsen und Schnaken sowie die Stechmücken als potenzielle Krankheitsüberträger größere Aufmerksamkeit. Über die Hauptmasse der Fliegen ist – nicht nur in Vorarlberg – kaum etwas bekannt. Niemand erachtet es als erstrebenswert, sich über die Fliegenklatsche hinaus mit dieser Tiergruppe zu beschäftigen. Und dies ist nur eine Gruppe, für die es kaum Artenkenner gibt. Aber auch bei den attraktiven Tieren sind Experten eine aussterbende Spezies. Das Erkennen der Arten, die Methoden der Probennahme auch für ökologische Fragestellungen werden auf den Universitäten nicht mehr gelehrt. Die organismische Biologie bringt kein in Zahlen fassbares wissenschaftliches Renommee, das letztendlich über die Geldverteilung innerhalb der Universität entscheidet.
Bei allen Fortschritten der Genetik fehlt uns die Basis. Kein Analysetool wird uns jemals ein ökologisches Gutachten erstellen. Im angewandten Bereich, bei der ökologischen Bewertung eines Naturraums ist weiterhin Expertenwissen gefragt. Doch woher sollen die Experten kommen, wenn die Ausbildung fehlt, wenn Studierende nicht mehr zur Eigeninitiative motiviert werden? Die inatura hat daher eine Idee der Österreichischen Entomologen Gesellschaft aufgegriffen: Bei einem Forschercamp sollen Studierende, Lehrende und Experten mit Praxisbezug in einem abgegrenzten Gebiet ausgewählte Tiergruppen gemeinsam erfassen und bestimmen. Wissenstransfer zwischen den Generationen war eines der erklärten Ziele des Projekts. So ging Anfang September das erste inatura Forschercamp im Europaschutzgebiet Gadental über die Bühne. Dieses abgelegene Seitental im Großen Walsertal ist seit den 1980er-Jahren ein Naturwaldreservat und Kernzone des Biosphärenparks. Seit Jahrzehnten wird der Wald nicht mehr bewirtschaftet. Tote Bäume bleiben liegen und bieten mit ihrem abgestorbenen Holz Lebensraum für viele Insekten. Damit war es nur logisch, Käfern, die auf Totholz angewiesen sind, besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Einen weiteren Schwerpunkt bildeten die wenig beachteten Bodenbewohner, darunter Würmer, Hundert- und Tausendfüßer sowie Spinnentiere. Und natürlich durften auch die Nachtfalter nicht fehlen.
Die richtige Probennahme stand am Anfang. Bereits im Vorfeld wurden an repräsentativen Standorten Fallen vergraben. Am Boden laufende Kleintiere sollten in simple Joghurtbecher mit einer Konservierungsflüssigkeit fallen. Die Fallen wurden nun von den Studierenden geborgen. Das Auslesen erfordert etwas Überwindung: Ertrunkene Schnecken machen die Probe nicht sonderlich appetitlich. Aber das Vorsortieren ist – nebst einer peniblen Dokumentation des Standorts der Fallen – Voraussetzung für eine aussagekräftige Auswertung. Laub- und Nadelstreu sowie Totholz wurden in speziellen Siebsäcken nach Größe getrennt. Hier ist die Auslese einfacher: Das Siebgut wird locker auf weiße Planen gestreut. Wer sich bewegt, hat verloren, und ein Saugrüssel befördert das unvorsichtige Tier ins Sammelgefäß. Natürlich wurde auch die normierte Entnahme von Bodenproben demonstriert. Im Seminarraum im Alpengasthof Bad Rothenbrunnen folgten erste Bestimmungsarbeiten unter dem Mikroskop. Bis alle Ergebnisse des Camps veröffentlicht werden können, wird es freilich noch etwas dauern. Speziell kleine Tiere, die unter dem Mikroskop studiert werden müssen, erfordern mehr Zeit, als in den wenigen Tagen zur Verfügung stand. Doch bereits jetzt steht fest: Alle Beteiligten, Studierende wie Experten, empfanden das Camp als Bereicherung. Und neben allem wissenschaftlichen Anspruch kam auch die Geselligkeit nicht zu kurz. Vielleicht dürfen wir in naher Zukunft jemanden aus dieser Gruppe als neue Expertin, als neuen Experten – für welche Tiergruppe auch immer – im Ländle begrüßen.

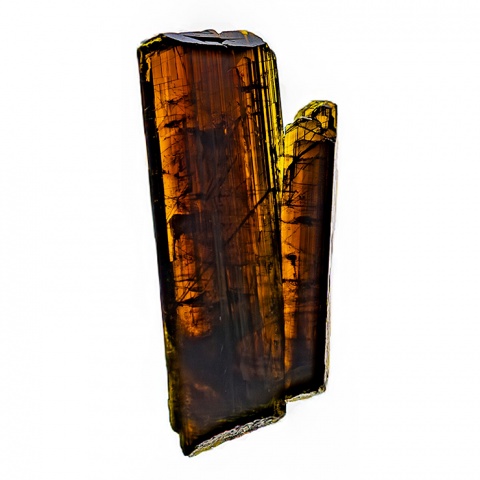









Kommentare