
„Wir wollen das Bewusstsein dafür schärfen, was Architektur bewirken kann“
Verena Konrad (36), Direktorin des Vorarlberger Architektur Instituts vai, sagt im „Thema Vorarlberg“-Interview, dass sich die hiesige Architektur vom Ruf der goldenen Jahre emanzipiere: „Das ist auch gut so. Ständig das Gleiche zu reproduzieren, bringt keine Entwicklung.“ Konrad über einen Beruf, in dem Selbstausbeutung offenbar gang und gäbe ist, über Probleme durch Normierungen – und über das spezifische Phänomen der „Vorarlberger Lücke“.
Was ist eigentlich Architektur?
Architektur ist die reflektierte Auseinandersetzung mit gebauter Umwelt, die bewusste Planung und Gestaltung von Raum auf Basis von identifizierten Bedürfnissen. Der zentrale Inhalt ist das Konstruieren von Bauwerken. Gute Architektur geht von einem sehr hohen Reflexionsgrad aus, berücksichtigt, was der Bauherr braucht, was gesellschaftlich wertvoll ist, unter Einbeziehung aller damit verbundenen Dimensionen – sozialer, politischer, ökologischer, ökonomischer, technologischer wie ästhetischer.
Das wäre dann die Idealvariante. Architektur ist allerdings, nimmt man ein durchschnittliches Einfamilienhaus her, immer auch ein Kompromiss – zwischen dem, was man gerne hätte, und dem, was man finanzieren kann.
Bezogen auf das Resultat ist das sicher richtig. Das Planen von Bauwerken ist mit Zeit und Mühe verbunden und hat seinen Preis, die Umsetzung ebenso. Wir gehen davon aus, dass qualitätsvolle Architektur nicht nur durch das Engagement von Architekten, sondern als Gesamtleistung zusammen mit den Bauherren, den Handwerkern und allen an der Umsetzung Beteiligten entsteht. Gute Architektur braucht den Bauherren als reflektiertes Gegenüber und als Investor.
Sie sagten vor Kurzem, dass sich Vorarlbergs Architektur vom Ruf der goldenen Jahre emanzipiere …
Ja. Diese Emanzipation ist auch notwendig. Sie ist grundsätzlich notwendig, wenn Entwicklung möglich sein soll. Das Architekturgeschehen in Vorarlberg ist seit den 1960er-Jahren ein spannendes Feld, in dem sich auch die gesellschaftliche Entwicklung gut ablesen lässt. In den letzten 40 Jahren hat es eine intensive Bautätigkeit im Land gegeben. Im Rahmen dieser Bautätigkeit gibt es viele einzelne Strömungen. Eine davon ist die gestalterisch höchst anspruchsvolle Holzbaukunst, die seit den 1990er-Jahren auch medial stark fokussiert wurde. Das vai, 1997 gegründet, war daran nicht unbeteiligt. Die international sehr gut rezipierte Ausstellung „Konstruktive Provokation“ hat einige Jahre später dazu beigetragen, diesen medialen Hype inhaltlich zu untermauern. Vorarlberg ist in der öffentlichen Wahrnehmung seither ungebrochen mit dem Thema „Architektur“ verbunden. Die hohe mediale Aufmerksamkeit, vor allem auch durch die touristische Kommunikation, ist aber auch verbunden mit der Gefahr einer Klischeebildung. Klischees führen, sehr verallgemeinernd ausgedrückt, zu fortlaufenden Kopien des immer Gleichen. Das halte ich für problematisch.
Le Corbusier sagte: „Vergesst die Gewohnheiten, vergesst die Tradition.“
Tradition ist wertvoll – es wird aber schwierig, wenn sie zum Dogma wird. Tradition ist dann gut, wenn man auch den Mut hat, sie zu überwinden, wenn die Analyse der damit verbundenen Werte und Haltungen Basis für neue Entscheidungen bleibt. Es spricht überhaupt nichts dagegen, Gutes beizubehalten, solange man nicht das Neue aus dem Blick verliert. Der Diskurs darüber, was gut ist, also das Ausverhandeln der Qualitätsmaßstäbe, ist eine kulturelle Aufgabe und Teil eines dynamischen Prozesses.
Sie sagten zuvor allerdings, dass sich die Architektur in Vorarlberg im Moment selber kopiert. Das wäre dann Stagnation …
Teile der Architektur stagnieren im Moment. Das ist kein neuer Befund. Vor allem im Sektor des Wohnbaus sind wirtschaftliche Zwänge mittlerweile zur Bremse von Innovation geworden. Ausnahmen bestätigen die Regel. Es braucht dringend einen öffentlichen Diskurs über Rahmenbedingungen des Bauens – über Bodenpreise, Errichtungskosten und Normierungszwänge –, um hier wieder eine gegenläufige Entwicklung zu initiieren. Im privaten Wohnbau gibt es die Entwicklung, die medial transportierten Typologien zu kopieren – selten sind hier Architekten involviert. Auch das lässt sich mittlerweile in den Ortsbildern ablesen. Gewerbe und öffentlicher Bau hingegen sind nach wie vor Vorbild und Vorreiter – auch in den letzten Jahren gibt es hier herausragende Beispiele für gute Planung und Umsetzung. Vor allem die Städte und Gemeinden haben, wenn sie als Bauherr auftreten, eine große Vorbildwirkung für die Bürger – damit die Menschen ein Bewusstsein dafür entwickeln, welche Möglichkeiten Architektur überhaupt eröffnet. Die Gemeinde Krumbach etwa zeigt, dass mit einer Passivwohnhausanlage mitten im Dorfzentrum zeitgenössischer, lebenswerter und ästhetisch wertvoller Wohnraum entstehen kann, der einen ökologischen Mehrwert hat und bezahlbar ist. Was hier passiert, hat gesellschaftlichen Mehrwert.
Zurück zum privaten Wohnbau. Fehlen da die einstigen Visionäre, die Vorarlbergs Architektur über die Grenzen des Landes hinaus bekannt gemacht haben?
Nein. Ich sehe das auch als gesamteuropäische Entwicklung. Letztlich ist Vorarlberg hier noch immer ein sehr guter Standort. Ich würde es eher so beschreiben: Es fehlt das breite Bewusstsein dafür, was Architektur eigentlich bewirken könnte. Architektur könnte wesentlich mehr, als die meisten Bauherren – private wie gewerbliche – je vermuten würden. Hier setzen wir als vai auch an, indem wir Architekturthemen im Alltag breit streuen
Aber gerade die Bauträger haben sich gegenwärtig der maximalen Ausnützung verschrieben.
Diese Entwicklung ist eine globale und Wirtschaftlichkeit ist ein wichtiger Faktor. Schwierig wird es nur dann, wenn architektonische Qualität überhaupt keine Rolle mehr spielt – wir reden da nicht über Architektur im Sinne von ästhetischer Gestaltung, sondern im Sinne von Raumorganisation und sozialen Dimensionen. Wie werden Räume – gesellschaftliche Räume – gestaltet? Was sind private, was sind semiöffentliche, was sind öffentliche Flächen? Das sind alles Themen von Architektur. Wenn man die gut löst, dann entstehen qualitätsvolle Räume, die ein gutes Miteinander und eine gute Lebensqualität bedeuten. Das ist die politische Dimension von Architektur. Allerdings herrscht in den vergangenen Jahren, im Übrigen nicht nur in Vorarlberg, in diesem Bereich eine ganz große Stagnation. Die Wohnkonzepte der vergangenen Jahrzehnte werden immer und immer wieder kopiert. Neue Lebensrealitäten, die etwa durch vermehrte Singlehaushalte, Patchworkfamilien oder den Wunsch nach generationenübergreifendem Wohnen entstehen, finden darin kaum Berücksichtigung. Auch wenn es natürlich Ausnahmen gibt, sind die großen Wohnbauprojekte in Vorarlberg derzeit nicht gerade innovativ.
Friedrich Achleitner sagte: „Für die jungen Architekten ist es viel schwieriger. Durch den Einfluss der Bauträger ist alles kommerzialisiert, und die Bürokratie ist zum Teil unmenschlich geworden. Es ist ein verdammt harter Beruf geworden, ein Selbstausbeuterberuf.“ Ist das nicht eine zu krasse Diagnose?
Nein, überhaupt nicht. Es gibt natürlich Büros, denen es sehr gut geht. Aber zu glauben, dass Architektur ein Beruf ist, mit dem man sich eine goldene Nase verdienen kann, trifft die Realität nicht ganz. Architektur als Sparte zählt zur Kreativindustrie. Und in der Kreativindustrie ist Selbstausbeutung gang und gäbe. Ein Beispiel: Architekten machen bei Wettbewerben mit, gewinnen dann nur den zweiten oder dritten Platz oder gar nichts und haben dafür hunderte Stunden Arbeit investiert, die niemand zahlt. Oder sie gewinnen einen Wettbewerb und dann wird das Siegerprojekt mitunter gar nicht realisiert. Das ist im Übrigen eine Entwicklung, die man sehr kritisch sehen muss. Für Architekturbüros ist das wirtschaftlich äußerst problematisch. Und es ist vor allem ein Problem für junge Architekten.
Das überrascht dann doch – bei dem Ruf, den die Vorarlberger Architektur genießt.
Nochmals: Es gibt natürlich auch Büros, denen es gut geht. Aber alle Büros haben Spitzenzeiten, in denen sie Mitarbeiter einstellen, und Zeiten, in denen diese wieder wegrationalisiert werden müssen – je nach Umfang der laufenden Projekte. In diesem Beruf gibt es eine immens hohe Fluktuation. Würde ich Ihnen heute eine Zahl nennen, wie viele Beschäftigte es in Vorarlbergs Architekturbüros gibt, wäre diese Zahl morgen schon wieder eine andere. Prinzipiell gilt: Das Erzeugen von Architektur als Beruf ist kommerziell schwierig. Wer zahlt beispielsweise gerne einen Entwurf? Viele private Bauherren erkennen den Entwurf nicht als reale Leistung an, dabei ist das der Kern des Geschäfts.
Haben Sie ein Lieblingsgebäude in Vorarlberg?
Nein. Aus Prinzip nicht. Das vai interessiert sich nicht nur für die Leuchttürme, sondern auch für Architektur in der Breite. Würde ich einige wenige Gebäude herausheben, würde ich erst wieder zur Klischeebildung beitragen. Klischees helfen uns nicht weiter.
Und welches ist das hässlichste Gebäude Vorarlbergs?
Das würde ich nie sagen. Außerdem kenne ich nicht alle. Ich versuche, diese Formen von Bewertung zu vermeiden, damit täte ich der Baukultur in Vorarlberg nichts Gutes. Mir geht es darum, das Architekturgeschehen in Vorarlberg kritisch zu reflektieren – in einem guten Ton. Dennoch interessieren mich Bewertungen, wie sie Roland Gnaiger und Walter Fink in der ORF-Serie „Plus Minus“ gemacht haben. Eine kritische Reflexion ist aber nicht nur an ästhetische Kriterien gebunden.
Architekten wünschen sich weniger Normen und mehr Freiraum.
Ja. Normen können Rahmenbedingungen schaffen, die den Wettbewerb regulieren und generell Vergleichbarkeit schaffen. Aber die kreativsten und die besten Lösungen entstehen oft im freien Planen. Normierungen sind schon deshalb ein Problem, weil sie in der Planung viel einschränken – und weil sie auch manche Produkte und Technologien in den Vordergrund rücken, die man sonst vielleicht gar nicht verwenden würde.
Es heißt, dass die Architektur im Land unter den Vorgaben des Energieinstituts leidet.
Das vai ist im Vorstand des Energieinstituts durch mich vertreten. Wir bringen unsere Argumente daher direkt ein, es gibt eine offene und wertschätzende Diskussion – auch über diese Vorbehalte, die hauptsächlich mit Normierungen zu tun haben. Im Prinzip geht es hier um die Kritik gegenüber einer dogmatisch ideologischen Haltung, wonach man gewisse Dinge tun darf und andere nicht. Ich würde sagen, dass viele Architekten zu einer kritischen Masse in der Bevölkerung gehören, die grundsätzlich ein Problem mit Dogmatik und Normierung hat. Das hat auch mit einem intellektuellen Zugang zu tun. Diesen Zugang unterstütze ich sehr. Ich versuche immer daran zu erinnern, dass Architektur keine Rechenaufgabe ist und bewusste Planung wesentlich mehr als nur das Einhalten von Richtlinien. Planerische Entscheidungen sollten aus Überzeugung getroffen werden. Architektur ist eine freigeistige Tätigkeit, eine kulturelle Aufgabe, die nicht auf dem Papier oder am Computer erledigt wird, sondern durch verantwortliches Handeln. Wir im Vorarlberger Architektur Institut verstehen Architektur als soziale und politische Praxis. Dass Ökologie und Nachhaltigkeit für die Architektur in Vorarlberg wichtig sind und bleiben, daran möchte ich nicht rütteln.
Eine letzte Frage noch. Das zersiedelte Rheintal dürfte eine große Herausforderung für die Architektur sein …
Diese Problematik ist nicht nur im Rheintal präsent und ist generell nicht nur architektonisch oder raumplanerisch anzugehen, sondern in erster Linie politisch auf der Ebene der Stadt-, Gemeinde- und Regionalentwicklung. In der Bautätigkeit wird die Problematik jedoch sichtbar. Wenn wir über Zersiedelung reden, ist die Antwort für eine positive Entwicklung: qualitätsvolle Verdichtung. Viele Vorarlberger sehen das Wohnen in einem Wohnblock jedoch nach wie vor als Zeichen sozialer Schwäche. Es braucht noch etwas Zeit, bis sich hier die Kräfte verschieben. Diese Entwicklung ist aber schon wirtschaftlich nicht aufzuhalten. Gesellschaftlich relevant sind auch Themen wie jenes der „Vorarlberger Lücke“. Betrachtet man ein Vorarlberger Dorfgefüge aus der Luft, sieht man sehr deutlich freie Flächen. Diese Flächen werden in den Familien oft über Generationen vererbt und ohne Not nicht aus der Hand gegeben. Man bräuchte diese Flächen ganz dringend für die Verdichtung: für den Wohnbau, für Infrastruktur, für Durchwegungen … Vision Rheintal, an deren Gründung das vai maßgeblich beteiligt war, hat mit den „10 Denkanstößen für eine enkeltaugliche Quartiersentwicklung“ einen gedanklichen Leitfaden erstellt, der benennt, was es für eine gute Entwicklung braucht: den Bestand achten, auf Alltagstauglichkeit schauen und die Menschen in ihren sich wandelnden Bedürfnissen wahrnehmen, die Bevölkerung involvieren, flexible Wohnformen forcieren, Ressourcen schonen und Synergien fördern – um nur einige zu nennen.
Vielen Dank für das Gespräch!








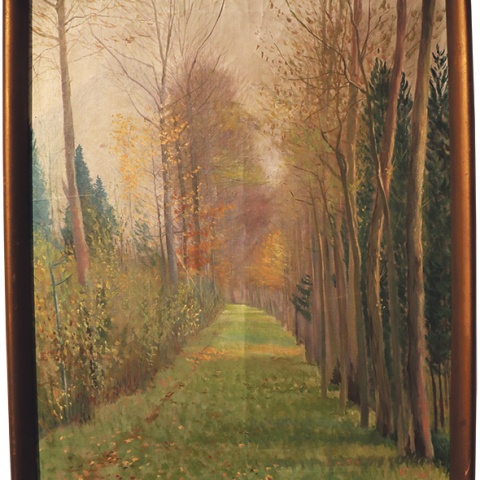




Kommentare