
Was kümmert uns Rilke
Am kommenden 4. Dezember 2025 jährt sich der Geburtstag von Rainer Maria Rilke (1875-1926) zum 150. Mal. Das Theater am Saumarkt nimmt dies zum Anlass, die heurigen Feldkircher Literaturtage von Donnerstag 22. bis Samstag 24. Mai dem großen Lyriker zu widmen.
Von Philipp Schöbi
Rilkes Gedichte prägen die Welt der Poesie bis heute. Und sie entzweien. Was für die einen schlichtweg großartig, wunderbar, zum Heulen schön und zuweilen lebensbegleitend geworden ist, ist in den Augen anderer nur herzergreifender Kitsch. Rilkes Themen handeln vom Schrecken des Schönen und vom Schönen des Schreckens. In Rilke lösen sich die Grenzen von Außenwelt, Innenwelt und Werk auf.
Wer aber war dieses androgyne und zerrissene Wesen, dessen poetischer Zauber bis heute so schräg, magisch und kryptisch, ja unwirklich in unsere Zeit hineinscheint? Wie erklärt sich die anhaltende Anziehungskraft seiner nicht selten bizarr und mystisch, zuweilen religiös anmutenden Texte? Und wie kommt es, dass diverse Aufenthaltsorte von Rilke, selbst wenn sie nur sehr kurzfristig waren, heute nachgerade als Kult- und Pilgerstätte begangen werden?
Das Mädchen René
Eine unfreiwillige Quelle von Rilkes vielfältigem Schaffen war zweifellos sein rastloses Leben, das seinen Anfang nahm in einer vor allem durch die Mutter geprägten traumatischen Kindheit. Er war auf die Welt gekommen, nachdem seine Eltern ein Jahr davor ein Mädchen, das Wunschkind seiner Mutter, kurz nach der Geburt verloren hatten. In der fixen Überzeugung, ihr Sohn sei nur im falschen Geschlecht geboren, gab sie ihm den Vornamen René, der Wiedergeborene (welcher auch in seiner weiblichen Variante Renée gleich klingt). Und sie erzog den Jungen, gegen den Willen ihres Ehemanns, als Mädchen, ließ ihm Locken wachsen, ließe ihn mit Puppen spielen und steckte ihn bis zu seinem fünften Lebensjahr in Röcke. Von allem Anfang an versuchte sie, den Jungen nach Maßgabe ihrer eigenen unerfüllten Wünsche und Träume zu formen. Gleichzeitig ließ es aber ihr genussorientierter, großspuriger, manierierter und exaltierter Lebensstil nicht zu, sich wirklich um ihren Jungen zu kümmern, sodass er quasi als ein Muttersöhnchen ohne Mutter heranwuchs. Dieses Trauma würde ihn für sein Leben prägen.
Der verlorene Sohn
Weil René partout nicht so tickte und spurte, wie seine Eltern es von ihm erwarteten, begriff er sich selber im Innersten als ein liebesunfähiges, krankes, überempfindliches, unterprivilegiertes, einsames Mängelwesen und zunehmend als eine Art verlorener Sohn – woraus auch seine lebenslange Scheu vor dem Familienleben hervorging. Aus diesem Befinden heraus erwachte in ihm jedoch schon früh ein unbedingter Wille, zu einem Dichter ohne Makel zu reifen. Seine frühesten dichterischen Versuche, so die einhellige Ansicht der Literaturkritik, verliefen allerdings kläglich. Aber er ließ nicht locker. Zunehmend suchte er das offene Leben der Bohemiens, übernahm zuweilen gar das distinguierte und aristokratische Gehabe seiner ungeliebten Mutter und vertraute, was sein Schreiben anbelangt, mehr und mehr dem höheren Diktat seiner „Engel“, nicht-christlich verstandenen Wesen zwischen Leben und Tod, die von einer höchsten Ordnung kündeten.
Facetten eines Dichters
Rilke entwickelte sich zum Meister im Anhören der Stille. Immerfort suchte er die Einsamkeit und pflegte ein Verhältnis zur vierten Dimension, zu okkulten Handlungen, zu Geistern und Schatten. Die Toten gehörten zum Leben. In der Öffentlichkeit wurde er als „Dichter der Einsamkeit“ und als „Poet des Unbewussten und Unterbewussten“ gepriesen. Manfred Koch bezeichnet ihn im Untertitel seiner vortrefflichen, neuen Rilke-Biographie als ein „Dichter der Angst“, bestimmten doch Ängste diverser Natur tatsächlich sein Leben. Und Sandra Richter beschreibt ihn in ihrer ebenfalls vorzüglichen neuen Rilke-Biographie als „in Wahrheit das Gegenteil des Esoterikers, zu dem er sich gerne stilisierte“. Tatsächlich sei Rilke „robust, durchsetzungsfähig, alert, mitunter heiter und selbstironisch“ gewesen. Und weiter: „Rilkes Wirkungspoetik zielte auf große Gefühle, darauf, alles Niedere, Hässliche, Düstere ins Hohe, Schöne, Geöffnete zu heben. […] Rilke schuf einen Textraum des Möglichen, in dem potenziell alles mit allem geheimnisvoll und vage miteinander in elegischer oder heiterer, schöner Beziehung stand.“ – Von vielen wurde Rilke auch als ein religiöser Lyriker und ein Gottessuchender angesehen, was irgendwie auch stimmen mag. Nur war Gott bei ihm ein übernatürliches Geistwesen jenseits aller Weltreligionen. Rilke war nicht fromm im herkömmlichen Sinne – die bigott-katholische Erziehung seiner gestrengen Mutter hatte es ihm für immer ausgetrieben.
Don Juan der Worte
In allen Frauen seines Lebens suchte Rilke letztendlich eine Mutterfigur, sei es in der um 14 Jahre älteren Lou Andreas-Salomé (1861-1937), sei es in seiner Ehefrau, der bärenstarken Bildhauerin Clara Westhoff (1878-1954) oder sei es in den unzähligen, meist schwerreichen und wesentlich älteren Gönnerinnen, die ihm in bemutternder Weise ein Überleben sicherten. Rilke war zwar ein Menschenfänger und literarischer Herzensbrecher: Seine Dichterlesungen fanden in Weihestimmung statt, und seine Bewunderinnen umflatterten ihn oft wie die Falter das Licht. Aber ein Don Juan war er definitiv nur auf dem Papier.
Stefan Zweig über Rilke
„Wenn wir heute in Deutschland ,Dichter‘ sagen, denken wir noch immer an ihn, und indes wir seine geliebte Gestalt noch mit den Blicken an all den Orten suchen, wo wir ihr begegnet sind, ist sie schon hinübergegangen aus unserer Zeit ins Zeitlose und Statue geworden im marmornen Haine der Unsterblichkeit.“ Mit diesen Worten beendete Stefan Zweig 1936 einen Vortrag über Rilke, nachdem er ein knappes Jahrzehnt davor in München für den Dichterkollegen schon eine Totenrede gehalten hatte.
Feldkircher Literaturtage
zum 150. Geburtstag von Rainer Maria Rilke (1875-1936) „Was kümmert uns Rilke“ 22. bis 24. Mai 2025, Theater am Saumarkt
Nähere Angaben zu den Feldkircher Literaturtagen unter www.saumarkt.at



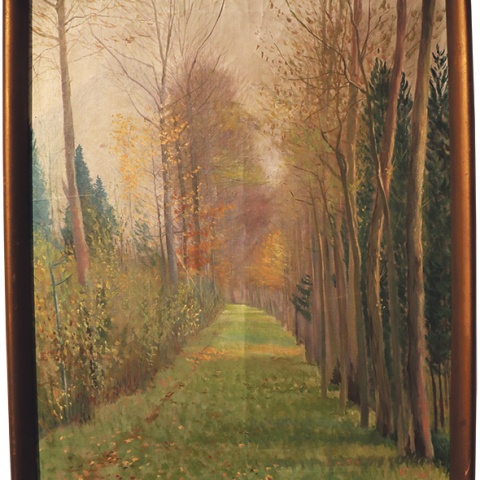




Kommentare