
Die Weberin und ihre Fäden
In meinen Kindheitserinnerungen steht ein Ereignis ganz oben: Der Besuch im Wiener „Würstelprater“ [sic! – mit dem Begriff „Wurstel“ konnte ich nichts anfangen, aber im Prater zogen mich auch die Würstelstände magisch an]. Neben Autodrom & Co. freute ich mich auf die Geisterbahn. Und zu jeder richtigen Geisterbahn gehörte auch ein Spinnennetz, dass den Gruselsüchtigen unvermittelt übers Gesicht strich. Natürlich ein künstliches, aber das tut dem Erschrecken, dem Ekel keinen Abbruch. Ja, Ekel, denn selbst wer von der Spinnenangst verschont blieb, kann auf Spinnfäden, die sich in seinen Haaren verfangen, gerne verzichten.
Es gibt etliche Meinungen, warum Spinnen von vielen Menschen als Bedrohung wahrgenommen werden. Da ist von kollektiv vererbten „Urängsten“ die Rede, ins menschliche Unterbewusstsein eingepflanzt in seiner urgeschichtlichen Heimat, wo die Konfrontation mit Giftspinnen öfter zu Komplikationen führte als später in unseren Breiten. Andere nennen das pelzige Aussehen mancher Arten, die acht Beine, die flinken Bewegungen. Oder eben das Spinnennetz, etwa wenn es in südlichen Ländern den Weg durch die Macchia versperrt, aber erst wahrgenommen wird, wenn man die Fäden bereits im Gesicht verspürt. Samt der zugehörigen Angst, dass sich das Tier selbst an oder – noch schlimmer – in der Kleidung verfangen haben könnte.
Hat man Angst und Ekel überwunden, so präsentieren sich Spinnen als faszinierende Lebewesen. In der Kulturgeschichte haben sie sehr unterschiedliche Spuren hinterlassen. Bleiben wir beim Netz und seinen Fäden. Für gar nicht wenige Arten ist es ein unverzichtbares Hilfsmittel beim Nahrungserwerb: Fliegendes Spinnenfutter soll sich in den klebrigen Fäden verfangen und so zur Beute werden. Dabei muss ein Spinnfaden starke Kräfte aushalten. Bei einer kleinen Mücke – kein Problem. Aber größere Insekten haben manchmal genügend Kraft, sich aus dem Netz zu befreien. Nur dann muss die Spinne schnell sein und ihr Opfer rechtzeitig betäuben. Bezogen auf ihre Masse ist Spinnenseide viermal so belastbar wie Stahl. Und sie kann, ohne zu reißen, um das Dreifache ihrer Länge gedehnt werden. Gleichzeitig ist sie leicht und wasserfest. Mikrobiellen Angriffen widersteht sie problemlos, und doch ist sie biologisch abbaubar. All diese Eigenschaften waren der Anlass, in manchen Ländern den Ekel in sein Gegenteil zu verkehren: Auf alten französischen Glückwunschkarten zum Jahreswechsel gehören Spinnen und ihre Netze zur fixen Grundausstattung an Glückssymbolen. Im Netz verfangen sich, an den Fäden hängen dann die allseits bekannten übrigen Glücksbringer wie Hufeisen und Kleeblatt: Das Glück hängt zwar an einem seidenen, aber am reißfestesten Faden der Welt!
Außer als Bildnis auf Ansichtskarten fand Spinnenseide auch praktische Bedeutung: Bereits in der Antike wurden Wundauflagen aus Spinnengewebe verwendet. Auch zum Fischfang finden die Netze mancher tropischer Spinnen Verwendung. Und im 19. Jahrhundert hat man gar Stoffe für Gewänder aus echter Spinnenseide gewoben. Diese Tradition aufgreifend, präsentierte das Victoria and Albert Museum in London im Januar 2012 einen Umhang aus Spinnenfäden. Für dessen Herstellung sammelte das Museumsteam auf Madagaskar die Netze von mehr als einer Million weiblicher Seidenspinnen. Die anglikanische Kathedrale in Chester (England) wiederum beherbergt ein besonderes Marienbild: Die Kopie des Gnadenbilds Mariahilf von Lucas Cranach dem Älteren auf dem Hochaltar des Innsbrucker Doms soll auf Spinnengewebe gemalt worden sein – so zumindest die Erläuterung auf einer historischen Ansichtskarte. Doch hier musste die Biologie korrigierend eingreifen: Keine Spinne lieferte den Malgrund, sondern ein kleiner Schmetterling namens Yponomeuta evonymella, die Traubenkirschen-Gespinstmotte.
Bei all ihren bemerkenswerten Eigenschaften fehlt es nicht an Versuchen, Spinnfäden künstlich herzustellen. So richtig gelungen ist dies noch nicht, und weiterhin ist die richtige Mischung der Proteine unbekannt. Als Symbol für die Synthese von Kunstfasern aber taugt die Spinne allemal. So finden wir sie und ihr Netz auf einer schwedischen Briefmarke zu Ehren der Nobelpreisträger für Chemie Karl Ziegler und Giulio Natta (1963). Ihren Forschungen ist es zu verdanken, dass Polyethylen und Polypropylen heute in großem Maßstab kostengünstig synthetisiert werden können.
Und noch einmal schauen wir nach Frankreich, und zurück zum Spinnennetz als Mittel des Schreckens: im Gebäude finden wir Spinnennetze – und die Reste der Spinnenmahlzeiten – bevorzugt in den Ecken der Zimmer, hinter und unter Möbeln, unter Vorsprüngen, kurz an vernachlässigten Orten, wo Besen und Staubsauger nur unregelmäßig für Ordnung sorgen. Dies war schon immer so, und so wurde das Spinnennetz nicht nur zum Glücksbringer, sondern gleichzeitig zum Sinnbild des Verfalls. Die Pariser Prostituierten des 19. Jahrhunderts nahmen dies zum Ausgangspunkt für eine wenig schmeichelhafte Metapher: Sie sprachen, dass jemand eine Spinne an der Decke = im Schädel habe, um anzudeuten, dass diese Person sich nicht normal verhalte und ein wenig gestört sei („avoir une araignée dans le plafond / au plafond“). Oder anders. Dass er sein Oberstübchen so sehr vernachlässigt habe, dass dort eine Spinne ihr Netz hatte weben können.
Es ist bemerkenswert, dass die Spinne, gleich wie ihr Netz, Ekelfaktor und Glückssymbol zugleich sein kann. Doch wie Arachnophobiker auf die Spinnenbilder der Glückwunschkarten reagiert haben, ist uns leider nicht überliefert.

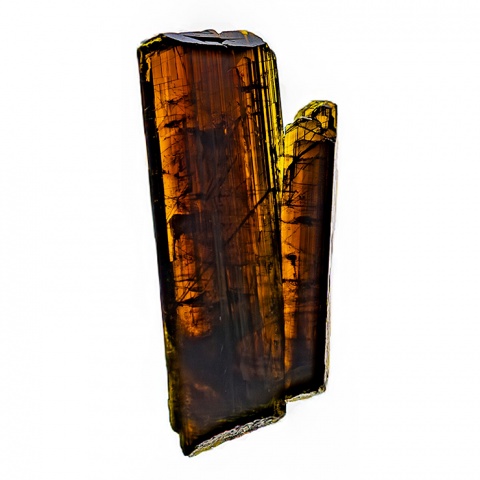









Kommentare