
Grenzfieber „Gschmugglat ischt nit gstohla“
Das Land der Schmuggler und Schwärz(l)er: Teil zwei der Trilogie berichtet von selbstbewussten Lustenauern und verachteten Mautbettlern. Kreishauptmann Ebner schrieb einst, dass „Beschwerden über Ehrenbeleidigungen und Exzesse aller Art, Raufhändel, Nachtschwärmerei, Saufgelage, Unsittlichkeiten, schwere Polizeiübertretungen und Verbrechen nirgends häufiger“ vorkämen als in Lustenau.
Eine alte „Zöllnerkultur“ gibt es in den Grenzdörfern entlang des Rheins aufgrund der nahen Schweizer Grenze, da das Schmuggeln zum Alltag gehörte. Nicht zuletzt als in den früheren Hungerjahren sowie in der Zwischenkriegszeit laut einer Anweisung des Kreisamtes von 1817 die „Einschwärzung“ verbotener Waren, aber ebenso die „Ausschwärzung“ von lebenswichtigen Dingen, die man im Land behalten wollte, wie zum Beispiel Kartoffeln, Butter, Käse und Eier verboten wurde. Ein Zollamt in Lustenau gibt es schon seit 1796. Geschmuggelt wurden Zucker, Saccharin, Tabak und Kaffee. Der Tabakschmuggel im großen Stil begann um 1800, als der Staat ein Tabakmonopol verfügte. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden vermehrt Zigarren geschmuggelt, Virginias und Brissagos. Die Schmuggler wussten, dass sie in den Gasthäusern dankbare Abnehmer ihrer über die Joche und über den Rhein geschmuggelten Waren fanden. Die Schmuggler waren meist Weltkriegsteilnehmer. Sie kannten keinen „Schiss“. Durch ihre Ausbildung an Waffen und ihre Erlebnisse im Krieg waren sie eher bereit, bei Schwierigkeiten mit den Grenzern den Kampf aufzunehmen. Zu den wichtigsten Strategien gehörte schlicht und einfach der Grundsatz: „Je näher beim Zollamt man schmuggelt, desto sicherer war man.“ Der geschickte Schmuggler braucht Mut, die Nähe der Zöllner zu suchen, um sich als unverdächtig darzustellen. Er wusste, die Bevölkerung war auf seiner Seite, denn für die Grenzbevölkerung war „der Zöllner“ ein überflüssiger Nichtstuer, der sich seine verwerfliche Tätigkeit noch dazu mit Geld der Steuerzahler bezahlen ließ und ansonsten nur eine Belästigung darstellte.
Aus einem Dokument im Lustenauer Archiv geht hervor, dass die Zollämter ein Leumundszeugnis von jenen Personen forderten, die sie des Schmuggels für verdächtig hielten. Mit ihren Verdächtigungen hatten es die Zöllner allerdings nicht leicht, da die Gemeindebehörde eher, wie aus anderen Unterlagen zu entnehmen ist, auf der Seite der Schmuggler stand. So wurde Anton Grabher, („Käterer“), mit Dekret der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch vom 12. Februar 1890 wegen Verdachts des Schmuggels unter Passkontrolle gestellt. Da Grabher durch diese Verfügung in seinem Stickereigeschäft nicht nur sehr eingeschränkt wurde, sondern darüber hinaus Gefahr lief, ganz ruiniert zu werden, wandte sich dieser in seiner verhängnisvollen Lage mit dem Ersuchen an die Lustenauer Gemeindevertretung, dieselbe wolle sich seiner annehmen und ihm das Zeugnis ausstellen, niemals als Schmuggler tätig gewesen zu sein. Die Gemeindevertretung sprach daraufhin ihr Bedauern über die Verhältnisse des Bittstellers aus und beschloss einstimmig, dem Grabher das Erklären abzugeben, dass er nie als ein Schmuggler gegolten habe und auch nicht als solcher bekannt sei.
Auf der anderen Seite standen die Zöllner. Ihre Aufgabe war alles andere als einfach. Sie hatten mit der psychologisch belastenden Situation zu kämpfen, dass die Bevölkerung den Schmugglern mit Sympathie, den Zöllnern aber mit offenkundiger, sich bis zum Hass steigernder Ablehnung gegenübertrat. Schlecht bezahlt und überfordert überwachten sie die Grenzen. Es ist schwierig, aus den Quellen eine objektive Darstellung der Auseinandersetzungen zwischen Zöllnern und Bürgern zu gewinnen. Ein und derselbe Vorgang konnte, je nachdem, wer ihn darstellte, zu vollkommen konträren Schilderungen des Tatgeschehens führen, sodass in einem Fall die Zöllner, im anderen Falle die Schmuggler die Bösewichte waren.
Selbstbewusste Lustenauer und verachtete Mautbettler
Landrichter Seewald erstattete am 17. Juni 1829 an das Kreisamt in Bregenz einen Stimmungsbericht über bedrohliche Spannungen zwischen Lustenauern und dem fremden österreichischen Zoll- oder Mautpersonal. Folgendes hatte sich zugetragen. Am Pfingstmontag wurde der singende Traubenwirtsohn Johann Hämmerle von zwei Grenzjägern zur Ruhe aufgefordert und nach seiner Weigerung mit einem Säbelhieb am Kopf verletzt. Einer der Mautner wurde von herbeigelaufenen Bauernburschen entwaffnet und festgehalten. Der andere holte zur Unterstützung zwei weitere Kordonjäger herbei, dann umstellten sie die Burschen mit aufgesetzten Bajonetten und drohten, wenn man den Mautner nicht sogleich freigebe, kommandiere der Chef:„Feuer!“. „Wenn sich die Zöllner weiter so benähmen und den jungen Burschen verbieten wollten, zu singen, zu pfeifen und mit der Peitsche zu knallen, bleibe sicher bald einer tot“, erklärten die rechtschaffenen Gemeindemänner ihrem Landrichter. Alle Zöllner, die bis dahin in Lustenau gedient hatten und an andere Orte versetzt worden waren, beschwerten sich bitter darüber, dass das gemeine Volk sich dort äußerst impertinent gegen sie auflehne, sie ins Angesicht „Mautbettler“ schimpfe, öfters mutwillig die Fenster im Zollhaus einschlage, nachts mit Steinen auf sie werfe und ihnen alles Mögliche „zum Possen und zur Verachtung“ tue, sodass es auch dem allergelassensten Mautner unmöglich sei, ein solches Benehmen ungerügt zu ertragen.
Interessant ist, dass die Zollbeamten in der Regel nicht aus der Gegend stammten, in welcher sie ihren Dienst versahen, in der Absicht, zu verhindern, dass eine Kumpanei zwischen Finanzern und Schmugglern entsteht. So war es auch entlang des Rheins. Die Zöllner, die zunächst kaum eine persönliche Beziehung zu den dortigen Menschen hatten, bemühten sich aufrichtig, Schmuggler zu erwischen. Da in Lustenau wie auch in anderen Gemeinden vor allem in Zeiten der Armut zwischen Bevölkerung und Schmugglern eine intensive Beziehung bestand, hatten es die Zöllner besonders schwer, Schmuggler zu überführen. Denn zu jener Zeit durfte ein Zöllner oder ein Gendarm bei Nacht in kein Haus eindringen. Sie mussten bis Tagesanbruch warten. Bis dahin hatten die Schmuggler, nachdem sie bemerkt hatten, dass das Haus in der Nacht von Gendarmen umstellt war, die geschmuggelte Ware bestmöglich im Haus versteckt. Alles jedoch konnten sie nicht verbergen, da es kaum derart viele geeignete Verstecke in einem Haus gab. Um sich aber dennoch des verbleibenden Schmuggelguts zu entledigen, haben sie dieses verbrannt. Sobald dann der Tag anbrach, haben die Finanzer das Haus nach Schmuggelware durchsucht und – wie nicht anders zu erwarten war – nichts gefunden. Auf die Frage der Finanzer, warum denn der Kamin in der Nacht geraucht hatte, bekamen sie zur Antwort, dass die Großmutter krank im Bett liege und eine warme Suppe ihr Wohlbefinden fördere. Ein guter Schmuggler musste kreativ und schlagfertig sein, denn ein Dummer kam nicht weit.
Kreishauptmann Ebner schrieb nach Innsbruck, die Bewohner der Gemeinde Lustenau gehörten zu den sehr rohen, aber dessen ungeachtet sehr ehrgeizigen und äußerst empfindlichen Menschen. Beschwerden über Ehrenbeleidigungen und Exzesse aller Art, Raufhändel, Nachtschwärmerei, Saufgelage, Unsittlichkeiten, schwere Polizeiübertretungen und Verbrechen kämen nirgends häufiger vor als in Lustenau. Kaum irgendwo dürfte es daher notwendiger sein, dass das gesamte Zollpersonal sich aller Äußerungen und Handlungen enthalte, welche die reizbaren Lustenauer in Harnisch brächten und nur unangenehme Folgen haben könnten. Die unverkennbare Hauptquelle dieser höchst bedauerlichen Verderbnisse sei nach allseitiger Überzeugung das Schmuggelwesen. Wer sich einmal diesem hingegeben habe, der sei für jede andere Schlechtigkeit reif. Bisher habe man vergebens versucht, dieses Übel zu steuern. Auch der tätigste Eifer der Behörden und das strengste Vorgehen gegen die Verbrecher vermögen nicht, diesem Umtrieb erfolgreich Schranken zu setzen.
Rohstoffmangel mit zunehmender Dauer des Ersten Weltkrieges
Während des Krieges hatte die Schmuggeltätigkeit erheblich zugenommen. Je länger der Krieg dauerte, desto stärker machte sich in Österreich die Knappheit verschiedenster lebensnotwendiger Waren bemerkbar. Infolge dieser Notlage hat der österreichische Staat verschiedene Waren, die in der Schweiz Ausfuhrverboten unterlagen, nach deren Einschmuggelung übernommen. In den Nachtstunden haben sich Schmuggler solcher Waren bei einem Zollamt gemeldet. Die Schweizer Grenzwacht ging sehr rigoros gegen diese Schmuggler vor und schoss häufig scharf. Leonhard Grässli, Schweizer Zöllner, beschreibt in seinem Buch „Grenzwächter und Zöllner, Erlebtes 1893–1971“ über Grenzerfahrungen in zwei Weltkriegen. 1917 in Rorschach im Grenzdienst eingesetzt, wird ihm bewusst, dass überall an der Grenze geschmuggelt wird. Und auch in Rorschach wird nicht lange gezaudert, wie er bemerkt. Bereits im geringsten Zweifelsfall wird geschossen. Und sei es auch nur Nächtens, wie in Castasegnas Kastanienwäldern auf das Licht von Leuchtkäfern, die auf das gebotene Halt der staatlichen Autorität nicht reagieren. Im selben Jahr wird Grässli zur Verstärkung nach Sevelen versetzt, da dort der Schmuggel über den Rhein weniger aufwändig ist als über den weiten Bodensee. Über das Zollamt Sevelen erfolgt nur geringer Personenverkehr nach Liechtenstein, das sich zu der Zeit noch unter Zollanschluss zu Österreich befindet. Zwischen der Schweiz und Liechtenstein blüht deshalb der Schmuggel. Fünf Grenzwächter, drei Heerespolizisten und Soldaten kämpfen dagegen an. Die österreichischen Zöllner kaufen im Auftrag des Staatsamtes für Heereswesen Nähfaden und Gummiartikel von den Schmugglern, da hieran in Österreich großer Mangel herrscht, unter dem insbesondere Frauen und die Uniformindustrie stark leiden.
Kamen die Schmuggler mit ihrer Ware erfolgreich über die Grenze, verdienten sie gut! Wurden sie jedoch vom Schweizer Zoll erwischt, wurden hohe Bußen, bis zum sechs- und bei Wiederholungstätern bis zum zwölffachen Warenwert bei gleichzeitiger Beschlagnahmung der Schmuggelware verhängt. Auch Passanten der Zollstraße versuchten auf alle möglichen Arten die Zöllner zu täuschen. Leibesvisitationen waren an der Tagesordnung. Selbst in den Absätzen der Schuhe und den Rohren der Fahrräder wurde Nähfaden versteckt. Jede Spule war drüben in Vorarlberg wertvoll! Im Unterrheintal, wo die in der Schweiz wohnenden Besitzer von Grundstücken jenseits der Grenze mit Wagen die Grenze passieren durften, gab es ausgehöhlte Deichseln, Wagenräder und Wagenbretter oder doppelte Jauchefässer. Hohle Werkzeugstiele, hohle Pferdekummet oder auch Mostkrüge dienten ebenfalls als Versteck für Nähfäden. Kreativität und Dummheit wechselten sich ab. Schmuggler nutzen Leichenwagen, versteckten den Kaffee in Benzintanks oder in Autoreifen. Kriegsveteranen stopften Kaffeebohnen in ihre Prothesen, Bastler konstruierten Kinderwagen mit doppeltem Boden.
Warenausfuhrverbot im kleinen Grenzverkehr
Zucker, ein österreichisches Staatsmonopol, war bei Kriegsende nicht mehr zu erhalten. Große Gewinne ließen sich schon lang zuvor mit Saccharin erzielen, einem Süßstoff, der seit 1886 industriell hergestellt werden konnte und einen höheren Süßigkeitsgehalt als Zucker besaß. Er war wegen der Kleinheit des Produktes bei Kontrollen kaum auffindbar und als Schmuggelgut so lukrativ, dass „(…) ihm ganze Familien ihren Wohlstand verdanken.“
Bezahlten die Schmuggler für das Kilo Saccharin in der Schweiz acht bis zehn Franken, so konnten sie dafür beim Verkauf in Österreich 50 bis 60 Franken erzielen. Auch für den Fall, dass das Saccharin durch mehrere Hände ging und überdies an Qualität verlor, weil es bei jedem Wechsel des Besitzers gestreckt wurde, blieb es gegenüber Zucker konkurrenzfähig. Tatsächlich kannte die Fantasie der Schmuggler keine Grenzen. Als Versteck benutzten sie unter anderem in den Zügen die Spülkästen der Klosetts. Das Saccharin wurde flüssig in Champagner Flaschen, als Pulver in Fahrradreifen, en bloc in Lastwagen mit doppeltem Boden, in Westen oder unter Röcken „eingeschwärzt“. Von einer geradezu geistlichen Originalität getragen war das Vorgehen einer Bande, die vornehmlich aus Österreichern bestand. Sie löste das Saccharin mit Wachs in Äther, formte daraus Kerzen und sandte diese nach Einsiedeln. Im schweizerischen Wallfahrtsort wurden die Kerzen dann geweiht und an eine eigens für diesen Zweck eingerichtete Devotionalienhandlung in Wien gesendet. Dort tauchte man sie in Natronlauge und schied aus der Lösung mit Salzsäure das Saccharin wieder aus.
Begehrte, teure Nahrungs- und Genussmittel
Kaffee war für viele das wichtigste und einträglichste Schmuggelgut. Grün musste er sein, also ungebrannt, ansonsten hätten die Grenzwächter sofort den Kaffee gerochen. Man brachte den Kaffee in großen Säcken zu den vereinbarten und vertrauten Garagen, Kellern oder Hütten in der Schweiz, wo er in kleinere, jeweils dreißig Kilo schwere Einheiten und Rucksäcke aufgeteilt wurde. So ging’s dann los, in einer mondlosen Nacht, mit geschwärzten Gesichtern und in dunkler Kleidung. Zu zweit oder zu dritt wurde aufgebrochen, mit großen Abständen. Und während einer voranging, verbargen sich die anderen. So war jedenfalls nicht alles verloren, sollte einer gefasst werden. Schmuggeln rentierte sich! In einer einzigen Nacht verdiente Sepp Alge, ein Urgestein unter den Schmugglern, einmal vierhundert Schilling. Als Geselle hatte er einen Monatslohn von nicht einmal sechshundert Schilling. Zahlreiche Mädchen, welche in der Schweiz Arbeit gefunden hatten, brachten in den Absätzen ihrer Schuhe, im Rahmen ihres Fahrrades und in anderen möglichen und unmöglichen Verstecken Waren nach Lustenau. Und ebenso wie in noch früheren Zeiten die Wilderer, so genossen auch die Schmugglerinnen und Schmuggler in weiten Kreisen der armen Bevölkerung hohes Ansehen.
Der Zusammenbruch der Donaumonarchie führte im Oktober 1918 zu unklaren Grenzverhältnissen, mit der Folge, dass der Schmuggel zwischen der Schweiz, Liechtenstein und Vorarlberg zunahm. Schmuggel war freilich kein neues Phänomen: Wenn auch in geringerem Maße war er im gesamten 19. Jahrhundert über die Pässe im Rätikon, über den Luziensteig, in der Region Schellenberg und in Booten über den Rhein von Bestand. Zwischen 1911 und 1915 wurden von der Finanz-Bezirksdirektion in Feldkirch rund tausend Schmuggler gefasst und etliche davon inhaftiert. In Vorarlberg rückten die Grenzgemeinden in den Mittelpunkt des Schmuggels. Nicht zuletzt verlief über den Eisenbahnknoten Feldkirch der transalpine europäische Fernverkehr in die Schweiz und von dort nach Frankreich, eine beliebte internationale Schmugglerroute mit erheblichem Volumen.
Die Texte stammen aus dem Buch „Grenzfieber. Land der Schmuggler und Schwärz(l)er“ Sigi Schwärzler, Eigenverlag 2018
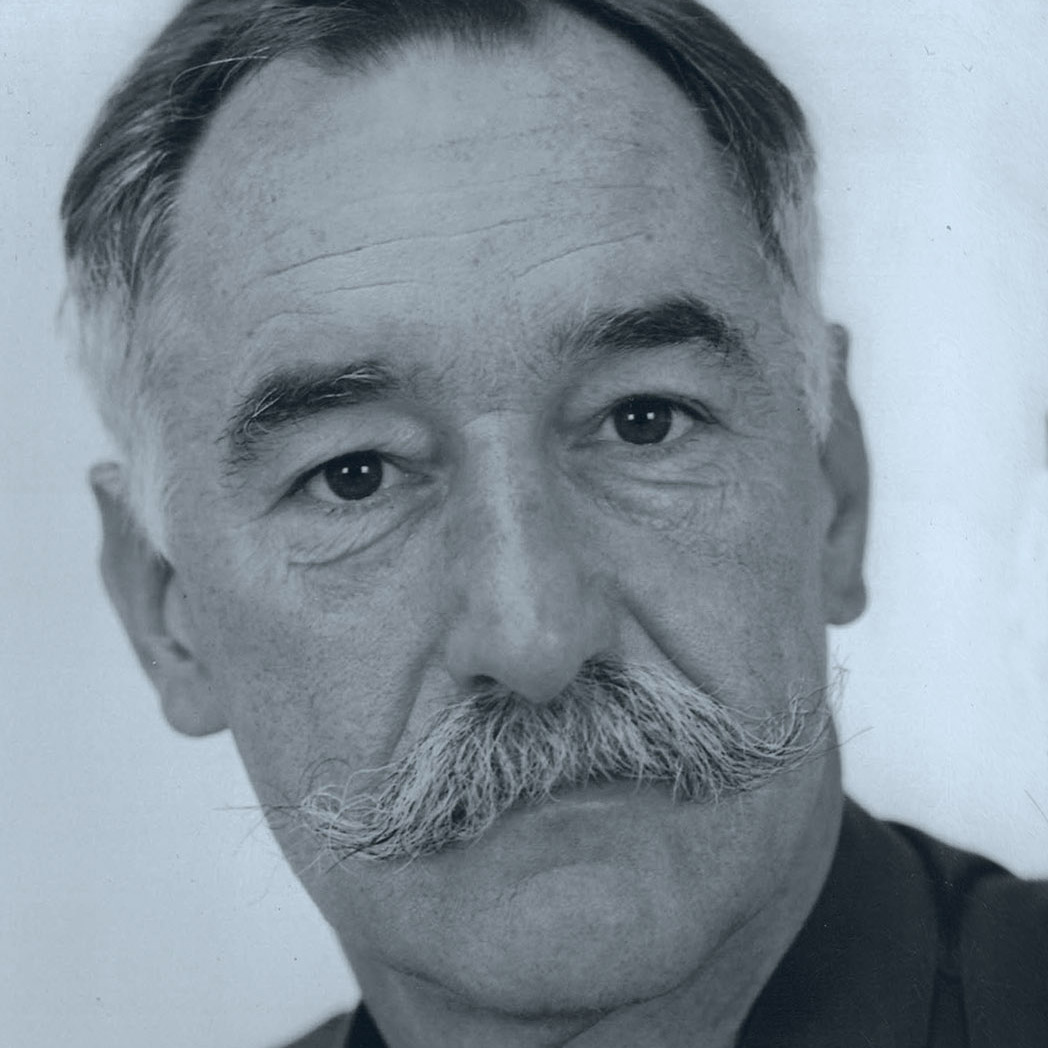














Kommentare