
„Österreichs Sprung ins Dunkle“
Der deutsche Politikwissenschaftler Michael Koß (45), ein profunder Kenner des österreichischen politischen Systems, spricht im Interview mit „Thema Vorarlberg“ über den Niedergang der einstmals großen Volksparteien,
über die Politik der Rechten und neue gesellschaftlich-strukturelle Konflikte.
Der Professor an der Universität Lüneburg sagt dabei unter anderem: „In Österreich ist zusammengewachsen, was nicht wirklich zusammengehört.“
Herr Koß, Sie nennen Österreich und Deutschland in Ihrem Buch nonchalant die „party crasher“ der europäischen Politik. Was meinen Sie denn mit diesem Ausdruck?
Damit meine ich, dass beide Länder innerhalb des europäischen Staatsverbandes als Enfants Terribles auftreten. Allein schon aus historischer Perspektive muss man Österreich, vor allem aber Deutschland ins Stammbuch schreiben: Mit zwei Weltkriegen, salopp formuliert, bekommt man keine Noten für gutes Betragen. Aber es geht auch gegenwärtig um eine fragwürdige Wandlung. Der alte demokratische Modus, in dem es darum ging, wer denn was bekommen soll, verwandelt sich in beiden Ländern mehr und mehr in einen radikalen, wenig demokratischen Konfliktmodus, in dem es darum geht, wer denn überhaupt noch am Tisch sitzen darf. Zwischen diesen Konflikten wurden und werden die Parteien der Mitte zermahlen. Etablierte, moderate Parteien drohen unter die Räder zu geraten.
Sie vergleichen das österreichische und das deutsche Parteiensystem und sprechen da wie dort von Volksparteien, deren Bedeutung sukzessive schwand und weiter schwindet.
Das wird vielfach auf Fehlverhalten von Politikern und Parteien zurückgeführt. Nun mag und kann ich auch gar nicht bestreiten, dass Politiker Fehler machen. Aber der tiefere Grund für den nachhaltigen Wählerschwund, dem Sozial- und Christdemokraten kumuliert ausgesetzt sind, ist nicht einfach nur das Unvermögen, neue Wählerschichten an sich zu binden. Vielmehr kann eine Partei heute gar nicht mehr als Volkspartei auftreten und von sich behaupten, sie vertrete die Hälfte oder gar die Gesamtheit der Wählerschaft. Das lässt die Konfliktstruktur gar nicht mehr zu. Früher war das anders. Verstand man sich wie früher beispielsweise nur als Arbeitnehmer oder als Arbeitgeber, dann war die Welt vergleichsweise einfach. Dann konnte man um so etwas wie Umverteilung streiten.
Und heute? Ist alles komplizierter, alles komplexer geworden?
Ja. Denn zu diesen früheren wirtschaftlichen Fragen kommen heute gesellschaftlich-strukturelle Konflikte, die sich nicht mehr an der Identität der Wählerinnen und Wähler festmachen lassen. Die Menschen stehen heute verschiedenen Entwicklungen wie Klimaschutz, Europäisierung, Migration entweder spinnefeind gegenüber oder sie begrüßen sie. Oder sie lehnen das eine ab und wollen das andere. Die verschiedenen Konflikte überkreuzen sich, sie können kaum noch gebündelt werden. In Österreich sieht man das sehr gut an der SPÖ. Nehmen Sie nur die unterschiedlichen Positionen des Herrn Doskozil und der Frau Rendi-Wagner, das sind eigentlich zwei Welten – innerhalb einer Partei! Das zeigt den Spagat, den die Sozialdemokratie machen muss. Doch die wundert sich eigentlich immer noch, warum nicht alle unter ihr Dach springen, wenn sie nur „Solidarität“ ruft.
Und was ist mit den Christdemokraten in beiden Ländern, also der ÖVP und der Union?
Im Vergleich mit den Sozialdemokraten stehen die Christdemokraten noch etwas besser da, weil sie immer noch einen Fuß in kulturellen Konflikten haben. Die Christdemokraten – Parteien der Fläche, der Peripherie und der Religion – haben Themen, aus denen sich immer noch politisch Honig saugen lässt. Aber auch die Christdemokraten werden grundsätzlich ähnliche Probleme gewärtigen. In Deutschland zeigt sich das bereits, und in Österreich hat sich die ÖVP mit dem türkisen Relaunch lediglich etwas Zeit erkauft.
Und was ist mit den Christdemokraten in beiden Ländern, also der ÖVP und der Union?
Im Vergleich mit den Sozialdemokraten stehen die Christdemokraten noch etwas besser da, weil sie immer noch einen Fuß in kulturellen Konflikten haben. Die Christdemokraten – Parteien der Fläche, der Peripherie und der Religion – haben Themen, aus denen sich immer noch politisch Honig saugen lässt. Aber auch die Christdemokraten werden grundsätzlich ähnliche Probleme gewärtigen. In Deutschland zeigt sich das bereits, und in Österreich hat sich die ÖVP mit dem türkisen Relaunch lediglich etwas Zeit erkauft.
Sie sehen ja insgesamt einen Trend weg von der Mitte, hin zu den Rändern.
Die neue Welle des Wettbewerbs, die durch die Parteiensysteme Europas schwappt, ist zuvorderst auf zwei zusehends erfolgreiche Parteifamilien zurückzuführen: einerseits auf die jeweiligen Grünen und andererseits auf rechtsradikale Parteien. Doch wie schwer die großen Konflikte auch in diesen Fällen zu bündeln sind, erkennt man daran, wie diffus beispielsweise die wirtschaftlichen Positionen sind: Grüne sprechen sich irgendwie für Umverteilung aus, sind aber noch nirgends dafür aktenkundig geworden, dem Rad des Neoliberalismus nachhaltig in die Speichen gegriffen zu haben. Und Rechte schwanken zwischen marktliberaler Deregulierung und einem ethnisch konnotierten Sozialstaat. Zwischen diesen beiden Positionen wird changiert, es ist eine wirtschaftlich-politische Indifferenz, die Grüne und Rechte gleichermaßen auszeichnet.
Apropos politische Indifferenz. Warum erschienen die heutigen Parteien und Politiker im Gegensatz zu ihren Vorgängern geradezu ideologiebefreit?
Die Gegenwart erscheint einem immer kompliziert. Das war früher so, das ist heute so. Allerdings haben wir heute keine Instrumente mehr, um politische Komplexität zu reduzieren. In der außergewöhnlichen Phase des Kalten Krieges hatte es diese ideologischen Leitplanken gegeben, sowohl nach rechts als auch nach links, in Österreich und in Deutschland: Nach links konnte man immer Anti-Kommunist sein, und zwar nicht nur als Christ-, sondern eben auch als Sozialdemokrat. Und nach rechts galt dasselbe. Nationale Alleingänge hatten sich mit Österreichs Neutralität oder mit Deutschlands Westbindung erledigt, und allzuviel Österreich-, respektive Deutschtümelei ebenso. In Österreich ist diese Brandmauer nach rechts aber viel früher gefallen als in Deutschland. Man könnte auch sagen: In Österreich hat die Zeit der Renegaten früher begonnen.
Können wir das näher erläutern?
Erstens war die NS-Zeit in Deutschland stärker dämonisiert. Ehemalige Nationalsozialisten waren im deutschen Parteiensystem mit keiner eigenen Organisation vertreten, während sie sich in Österreich im Verband der Unabhängigen (VdU) gesammelt hatten, dem Vorläufer der FPÖ. Zweitens nutzte Jörg Haider die Waldheimaffäre 1986, die einen Keil zwischen die Waldheim-kritische SPÖ und die Waldheim-treue ÖVP trieb, dazu, sich an die Spitze der FPÖ zu putschen und diese dann als Partei des österreichischen Nationalismus zu stilisieren. Und drittens war es im österreichischen Parteiensystem verlockender, die Brandmauer nach rechts im Hinblick auf die Mehrheitsbildung auf tönerne Füße zu stellen: Und um den vermeintlichen Teufelskreis der ewigen Großen Koalition zu durchbrechen, lag es nahe, auch die Freiheitlichen in Koalitionsüberlegungen miteinzubeziehen. All das machte es wahrscheinlicher, mit der FPÖ zu koalieren.
Inwieweit lassen sich eigentlich FPÖ und AfD vergleichen? Gibt es auch Unterschiede?
Es gibt große Unterschiede in der Vorgeschichte, in der Dauer, auch in der Häutung, die es zwischendurch gegeben hatte. Aber strukturell und politisch sind sich die beiden mittlerweile sehr ähnlich. Die Gemeinsamkeit liegt im Völkischen. Wobei die AfD seit ihrer Gründung 2013 in Riesenschritten das nachholt, was die FPÖ in über drei Jahrzehnten geschafft hat.
Könnte man beiden Parteien auch eine zumindest latente Geringschätzung parlamentarischer und demokratischer Strukturen bescheinigen?
Gut, dass Sie das ansprechen! Der völkische Nationalismus kann gar nicht demokratisch sein, weil er ja bestimmte Gruppen aufgrund ihrer Ethnizität bevorzugt, und das hat mit dem demokratischen Gleichbehandlungsprinzip nichts mehr zu tun. In diesem Drall zum Antidemokratischen finden sich beide, sowohl FPÖ als auch AfD zeigen eine manifeste Missachtung demokratischer Spielregeln. In Deutschland glaubt man übrigens, das juristisch einfangen zu können. Allerdings traue ich der AfD ein Ergebnis an die 20 Prozent zu. Und stellen Sie sich vor, man würde mit verfassungsrechtlichen Mitteln eine Partei bekämpfen, die sich auf ein Fünftel der Wählerschaft stützt! Das ist politisch kaum machbar.
Sie schreiben in Ihrem Buch, es beunruhige Sie die „Trägerschicht des Unmuts“.
Die Trägerschicht des Unmuts rekrutiert sich nicht aus den tatsächlichen Verlierern der Modernisierung, sondern stammt vielfach aus der von Soziologen so genannten alten Mittelschicht, also von Menschen, die zwar noch gut verdienen, deren Angst vor der Zukunft aber in Ressentiments umschlägt. Dazu kommt, zumindest in Deutschland, das große Problem, dass die Partei, die diese Trägerschaft des Unmuts in sich vereint, auch von Intellektuellen souffliert wird. Bestimmte Intellektuelle scheuen sich nicht, bis aufs unterste Argumentationsniveau zu steigen, um ihren Unmut zu artikulieren. Und das ist eine Mesalliance (Missheirat, Anm.) zwischen einer Partei und Intellektuellen, die es historisch schon einmal gegeben hatte: in der Zwischenkriegszeit.
Sie empfehlen den Lesern: Haben Sie ruhig ein bisschen Angst um die Demokratie!
Das grenze ich ab von der Angst in der Demokratie. Das ist die Angst der Mittelschicht davor, etwas zu verlieren; diese Angst, die einen kirre macht und in Ressentiments umschlagen kann, obwohl politische Entscheidungen mit kühlem Kopf getroffen werden sollten. Die Angst um die Demokratie ist etwas anderes: Da sollte sich jeder Mensch bewusst machen, dass es in der Politik heute mehr und mehr um die Frage geht, wer überhaupt noch am Tisch der Demokratie sitzen darf. Also, welche Partei trägt zu diesen Zugehörigkeitsspielchen bei? Das sollte sich jeder Wähler fragen. Und sich dann selbst sagen: Ich wähle in Zukunft eine Partei, die nicht ständig nach Sündenböcken sucht, sondern eine, die sich erkennbar bemüht, konstruktive Lösungen herbeizuführen.
Sie beschreiben im Buch Vergangenes und Gegenwärtiges, wir fragen: Was war Kreisky, was ist Kurz?
Ich will Kreisky nicht überhöhen, beispielsweise war sein Verhältnis zu seiner eigenen Religion aus heutiger Sicht nicht mehr nachvollziehbar. Aber er war schon so etwas wie eine politische eierlegende Wollmilchsau, er konnte im bis dorthin beispiellosen Wirtschaftswachstum der 1970er Jahre anbieten und umverteilen, ohne jemandem angeblich etwas wegzunehmen. Das wurde ihm abgenommen, nicht zuletzt in dieser spezifischen Konstellation des Kalten Kriegs und aufgrund seiner Biografie. Sebastian Kurz? Ich persönlich nenne ihn eine Lichtgestalt im Energiespar-Modus. In ihm gerinnt dieser neoliberale Zeitgeist recht gut. Inhaltlich indifferent, mit ambivalenter Haltung zur Demokratie und Mitstreitern, die loyal sind bis hin zum Kadavergehorsam, so würde ich ihn und sein Umfeld beschreiben. Kurz vollbringt schon auch Außergewöhnliches, aber er macht im Gegensatz zu Kreisky kein Versprechen mehr an alle, sondern nur noch an jene, die sich recken und strecken und dabei am besten noch ethnische Österreicher sind. Bestimmte Gruppen sollen unter den Tisch fallen, das ist die Übernahme der FPÖ-Programmatik.
Apropos. Wie sehen – oder werten – Sie eigentlich die Tatsache, dass Kurz zuerst mit den Blauen, nach Ibiza dann aber mit den Grünen koalierte?
Kurz‘ Ziel ist, das zu tun, was ihm eine Mehrheit sichert. Was das so genau ist, das ist für ihn nachrangig. Natürlich war die FPÖ der Wunschpartner, aber ihm war klar, dass die ihn mit dem Ibiza-Skandal nach unten ziehen würden. Kurz konnte von der FPÖ nicht mehr profitieren, er hatte sie ausgemolken. Also musste jemand anders her. Und da sich ÖVP und SPÖ in tiefster Abneigung verbunden sind, blieben zur Mehrheitsbildung nur noch die Grünen übrig. Ganz einfach. So sind die Grünen in die Regierung gekommen, per Ausschlussverfahren. Entsprechend sieht der Koalitionsvertrag aus.
Ist es das, was Sie mit dem Ausdruck „der österreichische Sprung ins Dunkle“ meinen?
Ja. In Österreich ist zusammengewachsen, was nicht wirklich zusammengehört. Die ideologischen Positionen der Türkisen und der Grünen liegen einander diametral gegenüber. Die Gretchenfrage dieser Koalition lautet nicht, was die Türkisen dazu bewogen hat, sondern warum die Grünen mit von der Partie sind. Sie können nur verlieren. Und stabil ist das auch nicht. Das ist Österreichs Sprung ins Dunkle. Deshalb gilt es, alternative Regierungsformen aufzuzeigen. Ich plädiere in Situationen, in denen eine parlamentarische Mehrheitsbildung eine sehr große Akrobatik erfordert, immer auch für eine Minderheitsregierung. Auch in Minderheitsregierungen gibt es ja Mehrheiten, nur eben für konkrete Gesetzesvorhaben. Deshalb wäre eine solche Regierungsform gerade in Zeiten des Umbruchs ein möglicher, erfolgversprechender Ausweg. Und dann müssten auch nicht zwei Parteien miteinander ins Bett steigen, die sich so überhaupt nichts zu sagen haben, wie die Türkisen und die Grünen. Denn diese Koalition hält ja wohl nur noch die Pandemie zusammen, mehr dürfte das nicht mehr sein.
Vielen Dank für das Gespräch!
Zur Person
Michael Koß * 1976 in Alfeld, ist ein deutscher Politikwissenschaftler mit den Schwerpunkten Vergleichende Politikwissenschaft und Demokratieforschung. Seit Oktober 2019 ist Koß Professor für Politikwissenschaft an der Leuphana Universität Lüneburg.
Weiterlesen!
Michael Koß
„Demokratie ohne Mehrheit? Die Volksparteien von gestern und der Parlamentarismus von morgen“
dtv Verlagsgesellschaft, München, 2021












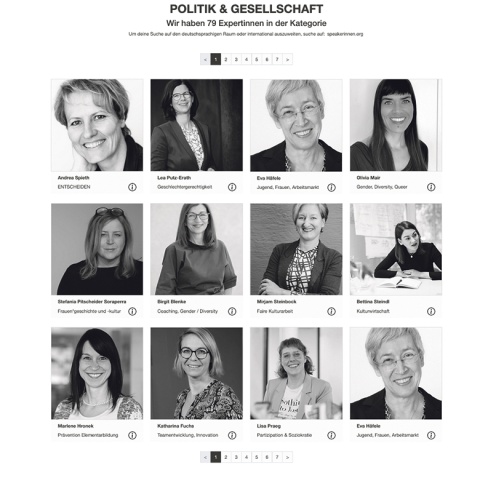

Kommentare