
Stich für Stich zur Individualität
Von der Idee, mit einem Tattoo dem „grauen Brei des Durchschnittsbürgers“ zu entkommen, und den Konsequenzen der Nadelstiche, die tief unter die Haut gehen.
Noch sind sie unter der warmen Winterkleidung versteckt. Aber schon in wenigen Monaten, wenn die Temperaturen wieder steigen und die Kleidung luftiger wird, treten sie zutage: Tätowierungen in allen Farben und Facetten. Waren sie anfänglich Seeleuten, Gefängnisinsassen oder Clanmitgliedern vorbehalten, gibt es heute keine Berufe oder Gesellschaftsschichten mehr, die ausgenommen sind: Tätowierungen sind salonfähig geworden. „Das Spektrum der Motivationen für ein Tattoo ist heute so breit wie die Menschheit“, sagt Erich Kasten, Professor an der Hamburger University of Applied Sciences und Experte für Body Modifications (wörtlich: Körperveränderungen). Für ihn sind Tätowierungen keine reine Modeerscheinung. Vielmehr gehe es um eine Steigerung der Attraktivität: „In einer überbevölkerten Welt, in der es Millionen gut aussehender Menschen gibt, ist es entscheidend, seine eigene Individualität mit Körperschmuck zu unterstreichen und dadurch unverwechselbar zu werden.“
„Tattoo statt Bücherregal“
Den Wunsch, sich „aus dem grauen Brei des Durchschnittsbürgers“ herauszuheben, nennt Kasten ebenso als Grund für ein Tattoo wie das Bedürfnis zur Selbstverwirklichung. „Viele Tätowierungen sagen auch etwas über die Persönlichkeit des Trägers aus. Wenn ich früher etwas über den Charakter eines Menschen wissen wollte, habe ich mir sein Bücherregal angeschaut. Heute blickt man auf seine Tattoos“, konkretisiert er. Ein spannendes Beispiel für Kastens Theorie ist die Vorarlbergerin Sandy P. Peng (siehe Bild). Sie legte sich mit Anfang zwanzig zum ersten Mal unter die Nadel eines Tätowierers. „Es tat höllisch weh“, erinnert sie sich noch heute. Der Schwur sich selbst gegenüber, sich diese Schmerzen nie wieder anzutun, hielt nicht lange: „Es kamen mit den Jahren einige Motive dazu“, erzählt Peng schmunzelnd und berichtet von den mittlerweile rund 350 Fotostrecken und 35 Titelseiten, die sie mit der stetig gestiegenen Zahl an Tätowierungen schon geziert hat. Daneben ist Peng auf zahlreichen Werbeplakaten für Tattoo-Conventions und heute vor allem in Kampagnen für unterschiedliche Tierrechtsorganisationen zu sehen, die sie auch als Aktivistin natio-nal und international unterstützt. Das professionelle Präsentieren ihres Körperschmucks ist für die im Eventbereich tätige Peng eine „kreative Freizeitbeschäftigung“, die sie früher „zeit-intensiv“ und heute nur noch sporadisch betreibt. Politische Statements transportiert sie keine auf ihrer Haut, die Motive bezeichnet sie als „positiv“, die meisten kämen „spontan“ und durch die Hand bzw. Nadel unterschiedlicher Tätowierer dazu.
Selbsttherapie und Mutprobe
Professor Kasten hält Tätowierungen unter anderem für eine Art Selbsttherapie. In einer aktuellen Studie, die er mit der Ärztin- Anika Wessel gemacht hat, stellte sich heraus, „dass viele Menschen an ihrem Körperschmuck regelrecht reifen“. Einige überdeckten körperliche Makel, unter denen sie schon lange gelitten hatten. Aber auch ein mangelndes Selbstbewusstsein könne der Grund sein, sich ein Tattoo stechen zu lassen. Der Knackpunkt bei den markanten Körperbildern dürfte deren „Ewigkeit“ sein. Der Experte berichtet, dass am häufigsten „selbst gestochene oder durch Laien angefertigte Tattoos“ entfernt werden. Viele von diesen würden nämlich aus gewissen Stimmungen wie Frustration oder Liebeskummer heraus oder im alkoholisierten Zustand entstehen. „Eine andere Gruppe, die versucht, die Hautbildchen verschwinden zu lassen, sind Leute, die – naiv und ohne groß darüber nachzudenken – blind dem Modetrend gefolgt sind, quasi weil es chic war und ‚dazugehörte‘. Sobald die Modewelle abgeebbt ist, stellen diese Leute fest, dass man das unmodern gewordene Motiv nicht einfach so ablegen kann wie das T-Shirt in der verblichenen Farbe der letzten Saison.“
Aber nicht jede Tätowierung kann weggelasert werden. Je bunter der Körperschmuck ist, desto schwieriger, langwieriger und teurer gestaltet sich laut Kasten die Entfernung. Außerdem wisse man nicht, was mit den winzigen Farbpartikeln passiere, in die das Tattoo bei der Entfernung zerschossen werde. „Sie verschwinden ja nach dem Lasern nicht einfach im Nirwana. Diese winzigen Teile werden zwar vom Lymph- und Blutsystem abgebaut, können sich dann aber in Filterorganen wie den Lymphknoten oder der Leber ablagern. Niemand weiß bislang, ob sie dort Schaden anrichten.“ Hier sieht er die Forschung gefragt. Kastens simpler Leitsatz für alle, die mit einer Tätowierung liebäugeln: „Think before you ink!“ – „Denk nach, bevor du zur Tinte greifst.“ Oder man macht es wie Sandy P. Peng. Sie hat sich von keiner ihrer Körperzeichnungen getrennt: „Auch mein erstes Tattoo habe ich noch – wenn auch in veränderter Form.“












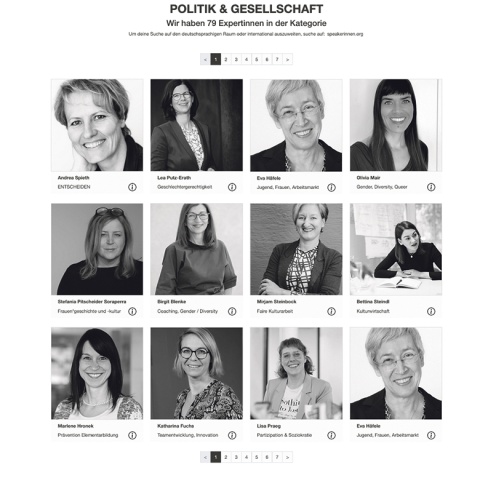

Kommentare