
Jahrmarkt der Sensationen
Der Begriff der Sensation beschreibt ursprünglich nichts anderes als eine Empfindung oder Wahrnehmung im Allgemeinen. Etwas, das wir durch unsere Sinne aufnehmen und durch kognitive Prozesse mit Bedeutung aufladen. Für den englischen Philosophen John Locke bedeutet Sensation die Erregung, die den Sinnen durch äußere Reize widerfahre, als auch die, in die sie den Organismus innerlich versetze. Mit seiner Auffassung von Sensation erhob er diese zum erkenntnistheoretischen Schlüsselbegriff des 17. Jahrhunderts schlechthin. Doch erst mit der Verstädterung und den damit einhergehenden sozialen Umwälzungen kommt es zu einer Bedeutungsverschiebung. Aus dem Allgemeinbegriff wird ein Inbegriff für all das Exzentrische, was das Stadtleben zu jener Zeit zu bieten hatte. Dabei war der Jahrmarkt das Zentrum der Zurschaustellung, ein gesellschaftlicher Knotenpunkt, an dem alles Auffällige und Kuriose zusammenläuft, ein Platz, an dem Händler, Marktschreier, Gaukler und Possenreißer um die Gunst der Besucher buhlen. Beim Kampf um Aufmerksamkeit waren die Akteure schon damals nicht zimperlich. „Abnormitäten-Schauen“ waren der große Renner. Sie entwickelten sich zu einem Massenvergnügen, und die Darbietungen versprachen ein Maximum an emotionaler Reizung. Das Publikum ergötzte sich am Anblick von Menschen mit körperlichen Fehlbildungen, die wie exotische Tiere vorgeführt wurden. Wenn wir die Lust am Andersartigen betrachten, kommen wir nicht umhin, uns Aristoteles und den Anfängen der Philosophie zuzuwenden. Der griechische Denker erkannte das Staunen als Triebfeder jeder seelischen Bewegung. Was aber ist es, was uns Menschen in Erstaunen versetzt? Nach Aristoteles ist es etwas Unerklärliches, das wir vor uns haben – etwa sich bewegende Marionetten, die Sonnenfinsternis oder die Inkommensurabilität der Diagonale. Doch das Staunen hat keinen Selbstzweck, ist auch kein Wahrnehmungsphänomen, das sich selbst genügt, sondern notwendige Voraussetzung für das Streben nach Wissen. Dieser Wissenseifer wurde später von der christlichen Kirche als gottgewollt ausgewiesen und strikt von der Neugierde abgegrenzt. Diese sei, so der mittelalterliche Kirchenlehrer Thomas von Aquin, nichts weiter als Augenbegierde, ein Sich-Vergaffen in aufregende Naturvorgänge, Schauspiele und schöne Frauen, das sich ins Sinnliche um des Sinnengenusses statt um des Schöpfers willen vertiefe. Der vom Dominikanermönch verteufelte zwecklose Sinnengenuss ist heute eines der auffälligsten Merkmale unserer Konsumgesellschaft, die das Aufsehenerregende, das Spektakuläre, das aus jeder Norm Fallende zum Standardrepertoire ihrer Welterschließungsakte zählt.
Die Jahrmärkte von heute sind das Fernsehen und das Internet, mit ihren unzähligen Schaubuden und Wunderkammern, Tingeltangel und Menagerien. Sie sind die modernen Umschlagplätze der Sensationen, die dem Prinzip der Erregtheit neue Territorien der Wirksamkeit erschließen. Eines der ersten Ereignisse, das die spektakulären Wirkungseffekte und ästhetischen Potenziale des Mediums Fernsehen demonstrierte, war die Echtzeitübertragung der Krönung Elisabeths II. aus der Londoner Westminster Abbey im Jahr 1953. Raumgrenzen zu überwinden, ohne dabei die Gleichzeitigkeit der Erfahrung zu verlieren, war für das Publikum jener Zeit ein Ereignis, das einer messianischen Offenbarung gleichkam. Die Intimität ohne körperliche Nähe, die Beteiligung ohne Anwesenheit, der Zauber der virtuellen Realität entfaltete seine volle Wirkung. Das ungewohnte Erlebnis des medialen Dabei-Seins hatte zunächst etwas Schockierendes, das den Wahrnehmungshorizont der Zuseher in bis dahin ungekannte Gefilde auszudehnen vermochte. Jedoch ist die Genese des Sensationellen durch die Tendenz zur Steigerung gekennzeichnet und nur so lange als ein außergewöhnliches Wahrnehmungsphänomen zu klassifizieren, solange eine physiologische Entsprechung vorliegt. Die Sensation steht in unmittelbarer Abhängigkeit zur Qualität, Funktionalität und Potenzialität medialer Ausstattungen. Sie ist somit Teil und Ausdruck einer mediengeschichtlichen Entwicklung, die durch Übergänge, Brüche und die Hervorbringung zahlreicher Vermittlungsoptionen bestimmt ist. Welche Herausforderungen mit dem kommunikationstechnischen Fortgang verbunden sind, war schon dem amerikanischen Schriftsteller Henry David Thoreau Mitte des 19. Jahrhunderts bewusst, lange vor der audiovisuellen Revolution und dem Internet. In seinem Buch „Walden“ bemerkt er: „Wir beeilen uns, einen Telegraphen zwischen Maine und Texas zu konstruieren, aber Maine und Texas haben möglicherweise gar nichts Wichtiges miteinander zu besprechen.“ Thoreau hatte erkannt, dass der Kanal nicht nur Kommunikation ermöglicht, sondern diese mit aller Vehemenz auch einfordert. Was das für die Medienmacher von heute bedeutet, ist augenscheinlich. Produktionsdruck. Denn alle Kanäle wollen gefüllt sein mit Aktuellem, Relevantem und Aufsehenerregendem, mit Wissenswertem, Unterhaltsamem und Erkenntnisreichem. Und die Angebote werden genutzt. Weltweit konsumieren wir rund neun Stunden täglich unterschiedliche Medieninhalte, wobei das Fernsehen mit einer durchschnittlichen Nutzung von drei Stunden an erster Stelle steht.
Mit der steigenden Anzahl an Publikationsmöglichkeiten verschärfen sich unweigerlich die Konkurrenzbedingungen, unter denen Informationen vermittelt werden, oder, besser gesagt, gemacht werden. Denn Nachrichten werden gemacht, sind Artefakte mit dem Anspruch auf Authentizität und Konsumierbarkeit. Um die Ware Information gewinnbringend anzupreisen, reicht es nicht aus, auf die vermeintliche Brisanz des Ereignisses zu setzen, sie will vermarktet und in Szene gesetzt werden. Nachrichten sind Teil einer Kulturindustrie, und ähnlich wie in der Politik, wo ideologische Trennwände zwischen links und rechts, progressiv und konservativ, sozialistisch und kapitalistisch immer durchlässiger werden, schwinden auch hier gelernte Muster der Unterscheidbarkeit. Informationen als Waren in einem freien Markt sind, genauso wie Schuhe, Autos oder zuckerfreies Katzenfutter, den Mechanismen der Verkaufsoptimierung unterworfen. Selbst die Tatsache, wenn sie denn eine ist, braucht die verführerische Ansprache, das auffällige Outfit, den marktschreierischen Ton, um in das Bewusstsein des Publikums vorzudringen. Eine klare Trennung zwischen Werbung, Unterhaltung und Nachricht treffen zu wollen, ist damit unsinnig. Natürlich unterscheiden sich Medienunternehmen in ihrer Ausrichtung, Aufrichtigkeit und Absicht voneinander, gibt es solche, die mit ihren Wirklichkeitskonstruktionen den Kern einer Sache besser treffen, die sich dem Berufsethos eher verpflichtet fühlen als andere. Die Spannbreite zwischen Wissenschaftssendung und Boulevardjournalismus, Tagespresse und Monatsmagazin, Talkshow und Weblog bietet genügend Platz für Sinn und Unsinn, doch liegt es in der Logik einer kapitalistischen Gesellschaftsform, Waren feilzubieten und Aufmerksamkeit zu generieren. Daran ist nichts Verwerfliches, solange es unsere Urteilskraft nicht völlig schwächt. Der US-amerikanische Autor und Medienkritiker Neil Postman stellte die Behauptung auf, dass das Fernsehen den rationalen öffentlichen Diskurs dahingehend verwandle, indem es jedes Thema, ob Politik, Kultur, Erziehung oder Bildung, zum Gegenstand emotionalisierter Unterhaltung mache. Mit Folgen. Denn wenn uns alles als ästhetischer Einheitsbrei vorgesetzt wird, dann kommt uns das Gefühl für Differenz abhanden, verlieren wir den Geschmack für die Nuancen und werden blind für die Schattierungen. Um Urteile zu fällen, brauchen wir jedoch den Vergleich, den geschärften Blick für Unterschiede sowie die Fähigkeit, moralische von nichtmoralischen Aspekten zu trennen. Was wir heute beobachten, ist eine Verschränkung unterschiedlicher kultureller Darstellungsformen, die sich bereits derart in unseren Wahrnehmungsraum eingeebnet hat, dass uns die kritische Distanz abhandenkommt. Die Durchmischung von Tatsachen, Inszenierungen und Täuschungen ist heute nicht nur geduldet, sondern Inhalt verschiedener Geschäftsmodelle. Die Frage nach der Wahrheit, die uns als Motor unserer gesellschaftlichen Entwicklung diente, verliert im ekstatischen Medienrauschen allmählich an Sinn. Entscheidend ist, was uns gefällt, was unseren Geschmack trifft, was in unser Weltbild passt. Die zu beobachtende Wahrheitskrise ist eine Krise der Wahrheit an sich. An ihre Stelle tritt die Plausibilität. Was so klingt, als könnte es wahr sein, wird dem persönlichen Bild von Wahrheit einverleibt. Im Grunde wollen wir weder die Wahrheit noch die Moral, wir wollen die Unterhaltung, das Spektakel, und das, was uns nützlich erscheint. Die systematische Erregung erfüllt zudem eine Schutzfunktion, die uns davor bewahrt, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Wir scheuen die Kontemplation, da sie Konfrontation bedeutet, nämlich mit unserem tiefsten Inneren. Dieses Zurückgeworfen-Sein auf das eigene Selbst beschreibt der dänische Schriftsteller und Philosoph Sören Kierkegaard als eine Einsamkeit, aus der uns nur der persönliche Glaubenssprung zu Gott rettet. Und wenn uns Gott abhandenkommt, dann suchen wir eben andere Zufluchtsorte auf, die mit dem Versprechen nach Selbstvergessenheit locken.
Mit dem Niedergang des Buchdruck-Zeitalters, der rapiden Entwicklung audiovisueller Apparaturen und der Ausbreitung des Digitalen verändert sich die Art und Weise, wie wir unsere Welt konstruieren, von Grund auf. Die Linearität der Erkenntnis, die durch die Beschaffenheit der Schrift determiniert ist, weicht einer ganzheitlichen Informationslogik, die all unsere Sinne stimuliert. Die Struktur der digitalen Vernetzung folgt keiner Anordnung, die von A nach B reicht, sondern macht uns zu Navigatoren in einem Raum völliger Distanzlosigkeit. Im Zeitalter des Digitalen sind wir Sender und Empfänger in einer Person und können uns beliebig in öffentliche Diskurse einbinden, vorausgesetzt, wir haben einen Internet-Zugang. Das Dabei-Sein des Fernsehens hat sich unter den Bedingungen der Netzöffentlichkeit in ein pausenloses Involviert-Sein mit Dauererregungspotenzial entwickelt. Kein Tag ohne Push-Nachrichten und visuelle Schocks, ohne Skandale und pulsierende Aufreger. Sogar das vermeintlich Banale und Triviale erhält durch das virale Moment des Teilens den Anschein hoher Bedeutsamkeit. Das digitale Universum ist ein offener Raum mit seinen eigenen Gesetzmäßigkeiten und Effekten. Nichts, was nicht in die Sphäre der Netzöffentlichkeit eindringen kann und seine Spuren hinterlässt. Das Gewesene wird zur ewigen Gegenwart, nichts wird vergessen, vieles passiert simultan und fordert einen kommentierenden Sofortismus, wie dies der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen formuliert. Die Lust an der Aufregung paart sich mit der Forderung nach Publizität, mit dem Ergebnis, dass wir uns in einer dichotomen Situation wiederfinden, in der wir einen über Jahre hinweg eingeübten Diskurs über Freiheit und Kontrolle auf neuer Grundlage führen. Der euphorischen Stimmung der Anfangszeit, als das Internet von Techno-Hippies als unbegrenzter Raum von Austausch und Demokratie gefeiert wurde, steht heute eine merkliche Verschlechterung des Kommunikationsklimas gegenüber. Vorbei die trunkenen Jahre, als wir noch an die Unfehlbarkeit des Internets glaubten. Heute blicken wir schon nüchterner auf das weltweite digitale Netzwerk, besser gesagt, in es hinein, denn es ist ein Spiegel unserer Gesellschaft. Es bringt nichts hervor, was nicht schon in uns angelegt ist. Das Schöne, Wunderbare, Hoffnungsvolle, Erbauende, Liebliche genauso wie das Brutale, Bestialische, Tragische, Verlogene und Hässliche. Mit dem schwindenden Einfluss der Qualitätsmedien und der klassischen Gatekeeper, die darüber entscheiden, welche Information in welcher Form den Weg in die öffentliche Sphäre findet, sind wir gefordert, neu über den Komplex von Publizität, Medienwirkung und Verantwortung nachzudenken. Der Medienumbruch geht einher mit einer Umgestaltung der Öffentlichkeit, die nicht notwendigerweise eine Adaption bestehender Gesetze verlangt, als vielmehr eine bildungspolitische Offensive, mit keinem geringeren Ziel als einer allgemeinen Medienmündigkeit.








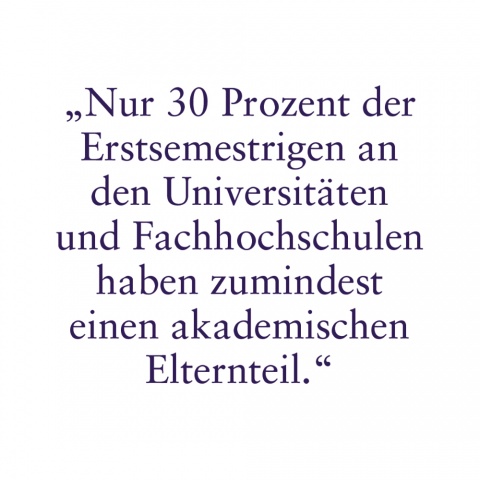





Kommentare