
Die Welt der Dinge
Wenn Sie in den 1990er-Jahren aufgewachsen sind, dann kennen Sie mit Sicherheit die US-Fernsehserie Knight Rider. Der junge David Hasselhoff spielt darin den Polizisten Michael Knight, der sich im Namen der Foundation für Recht und Verfassung dem Kampf gegen das Böse widmet. An seiner Seite ein schwarzer Pontiac Firebird Trans Am, ein cooler Sportwagen mit einem roten Lauflicht an der Fahrzeugfront. So weit, so gewöhnlich. Doch das Besondere an diesem Gefährt: Es kann denken, sprechen und selbst fahren. Zudem ist es launisch, humorvoll und trifft eigene Entscheidungen. Ein fahrender Supercomputer mit menschlichen Zügen, der Traum jedes Techno-Optimisten. Aber langsam. Mit einer Maschine auf Augenhöhe zu kommunizieren ist heute trotz Spracherkennungsprogrammen wie Alexa oder Siri noch Zukunftsmusik. Doch wie steht es um den aktuellen Status der Dinge in der Welt? Und was macht es mit uns und unseren gesellschaftlichen Prozessen, wenn wir Entscheidungen an Technologien delegieren?
Immer stärkere Rechenleistungen erobern den Raum und machen aus den Gegenständen soziale Akteure, die in unseren Alltag eingreifen. Ausgestattet mit hochentwickelten Sensortechnologien sammeln sie Daten und verwerten diese in einem übergreifenden Prozess digitaler Vernetzung. Dass Dinge mehr sind als bloße Erscheinungen, darauf machte bereits der Philosoph Martin Heidegger aufmerksam, indem er feststellte, dass Dinge nicht einfach daliegen, sondern unsere menschlichen Angelegenheiten austragen. Sie sind nicht passiv, sondern vereinnahmen unsere Welt. Unter den Zeichen des Digitalen erhält diese Bewertung eine ganz eigentümliche Dynamik. Wir haben es heute mit Gegenständen zu tun, die über ihre angestammte Funktion hinausweisen und eigene Handlungsmacht besitzen. Thermostate zeigen beispielsweise nicht nur die Raumtemperatur an, sondern analysieren unser Verhalten und agieren, indem sie selbstständig den Energieverbrauch regeln. Unterschiedliche Technologien machen aus den Gegenständen interaktive Medienobjekte, die in einem Internet der Dinge verbunden sind und sich in einem selbstlernenden Prozess auf unsere Nutzungsgewohnheiten einstellen.
Doch was hat das alles mit Lernen zu tun? Grundsätzlich gar nichts, würde der Hermeneutiker Hans-Georg Gadamer sagen. Denn Lernen heißt Verstehen, und das setzt Bewusstsein voraus. Nach Gadamer gelingt der Prozess des Verstehens dort am besten, wo wir uns Erkenntnisse aneignen, die wir in unser persönliches Wissen integrieren und in einen größeren Kontext stellen. So gesehen sind Maschinen nicht intelligent, sie sind bestenfalls nützlich. Sie machen keine Erfahrungen, sondern verarbeiten Informationen. Sie haben auch keine emotionalen Erlebnisse, sind nicht neugierig oder willens, sich etwas anzueignen. Somit fehlt ihnen jegliche Grundlage, Lernprozesse zu schaffen, die der Erkenntnisfindung dienen. Doch möglicherweise sind wir nur voreingenommen und haben falsche Vorstellungen von den Potenzialen technischer Handlungsabläufe. In einer Welt, in der Computer bereits unter Fingernägel passen und die Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine immer durchlässiger werden, scheinen sich die Grenzen des Machbaren zu verflüchtigen. Vielleicht entwickeln sich aus den technischen Potenzialen bald andere Bewusstseinsformen, die mit dem kognitiven Vermögen des Menschen nur strukturelle Eigenheiten gemein haben. Steht gar der nächste Schritt der Evolution bevor?
Durchaus möglich, wenn wir Befürwortern der künstlichen Intelligenz glauben möchten. Einer ihrer radikalsten Vertreter, der austro-kanadische Robotikwissenschaftler Hans Moravec, ist der Überzeugung, dass die Menschheit in absehbarer Zukunft als ein gescheitertes Experiment gelten wird. Keine rosigen Aussichten für uns Mitglieder der Homo-sapiens-Gemeinschaft. Doch keine Sorge. Noch haben wir ein weitgehend gesundes, sprich produktives Verhältnis zu unseren Dingen, die wir als kluge Gegenstände nutzen. Smart Home, Smart Mobility, Smart Cities, Smart Health, Smart Clothes – überall begegnen uns kleine Universen der Klugheit, an denen wir uns erfreuen. Doch was steckt hinter dem Hype um künstliche Intelligenzen und smarte Lebensweisen? Neben dem kindlichen Vergnügen des Experimentierens und handfesten wirtschaftlichen Interessen ist es vor allem das Bedürfnis nach Optimierung. Unsere Makel sind keine lieblichen Ausweise persönlicher Eigenheiten mehr, sie sind Hindernisse, die es zu überwinden gilt. Wir werden uns als fehleranfällige Wesen immer mehr zur Last, ob im Privaten oder Beruflichen. Wir glätten unsere Falten, designen unsere Babys, schaffen Maschinen, die unsere Arbeit effizienter verrichten, und entwickeln selbstfahrende Autos, um den Risikofaktor Mensch zu eliminieren. Wir optimieren wie besessen, ohne jedoch genau zu wissen, was das Optimale ist. Wir orientieren uns an Bildern permanenter Steigerung, die uns das Streben nach mehr Gesundheit, Sicherheit, Bequemlichkeit und Wachstum als humanistische Aufgabe suggerieren. Das Planbare wird glorifiziert, das Zufällige verpönt. Doch ist es nicht gerade das Unerwartete, das uns überrascht, uns fordert, uns reifen lässt? Aristoteles würde diese Frage mit Ja beantworten, denn er sah im Zufälligen den Grund des Staunens, das uns erst zu einer kritischen Auseinandersetzung mit einem Sachverhalt führt und uns zu selbstdenkenden Wesen macht.
Mit der Digitalisierung und technologischen Ausdehnung unserer Welt bieten sich faszinierende Möglichkeiten, unsere Lebensqualität zu verbessern. Es gehen damit aber auch demokratische Verluste einher, die so schleichend sind, dass wir sie kaum bemerken. Diese eingeschränkte Wahrnehmung von Wandel bezeichnet der französische Biologe Daniel Pauly als Shifting-Baseline-Syndrom. Die Veränderung unseres Äußeren erkennen wir auch nicht durch den täglichen Blick in den Spiegel, sondern erst beim Betrachten einer Fotografie, die uns vor zehn oder 20 Jahren zeigt. Diese Wahrnehmungsverzerrung machen sich Unternehmen wie Google, Facebook oder Apple zunutze, indem sie Wissen monopolisieren, Innovationen nach den eigenen Kriterien vorantreiben und sich politischen Regulativen entziehen. Oder haben wir jemals über eine technologische Erneuerung abgestimmt? Im Selbstverständnis der High-Tech-Unternehmen konstituieren sich demokratische Prozesse nicht durch aktives Mitgestalten vieler, sondern durch Klicks, Likes und Trackingraten. Und Google steht an der Spitze dieser Entwicklung, die sich gerne als ideologische Bewegung gibt.
Mit einem Marktwert von über 500 Milliarden Dollar hat sich der kalifornische Konzern in den letzten Jahren aus einem überschaubaren Internet-Unternehmen zu einer weltumspannenden Innovationsmaschinerie entwickelt. Ob fliegende Windturbinen, Kontaktlinsen zur Blutzuckermessung oder künstliche Gehirne, in geheimen Laboren wird enthusiastisch an der Welt von morgen gebastelt. Um diese zu realisieren, lockt der Konzern Jahr für Jahr führende Wissenschaftler, Forscher und Ingenieure mit hohen Gagen und Selbstverwirklichungsversprechen ins Silicon Valley. Ganz oben auf der Agenda des Unternehmens steht das Internet der Dinge. Ausgestattet mit einem globalen Betriebssystem sollen darin alle Gegenstände miteinander vernetzt sein. Angefangen mit unseren Häusern und Wohnungen, in denen Kühlschrank, Waschmaschine, Heizung und Fernsehgerät in einer digitalen Symbiose zur Verbesserung unserer Lebensqualität beitragen werden. So die verheißungsvolle Vision von Google. Doch ganz nebenbei werden Unmengen an Daten gesammelt. Was Google damit macht, bleibt Außenstehenden in der Regel verborgen. Genauso wie die Absichten des Konzerns, die sich irgendwo zwischen emphatischer Weltverbesserung und hegemonialen Fantasien bewegen. Es sind unsere Bedürfnisse, die Konzerne wie Google ins Auge fassen, Bedürfnisse, über die sie besser Bescheid zu wissen scheinen als wir selbst. Diese Wir-wissen-was-du-brauchst-Mentalität sollte jeden mündigen Bürger hellhörig machen. Oder haben wir uns schon so an Bevormundungen gewöhnt, dass wir diese nicht erkennen, wenn sie in guter Absicht daherkommen? Im Falle von Google ist es die unauflösliche Mischung aus Anmaßung, Genialität und Science-Fiction, die für viele den Reiz des Unternehmens ausmacht. Und wer fragt bei diesen heilsbringenden Zukunftsaussichten schon nach Datenschutz oder Persönlichkeitsrechten?
Es sind die Ambivalenzen, die unüberschaubaren Möglichkeiten der technologischen Entwicklung, die uns zwischen Begeisterung und Zurückhaltung schwanken lassen. Das Sowohl-als-auch des Technischen zeigt sich am Internet am deutlichsten. Als digitales Massenmedium bietet es eine unglaubliche Fülle an Informationen und Interaktionsmöglichkeiten, die den demokratischen Gedanken der Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen ausformuliert. Durch den Zugang zu Wissen stellen wir Autoritäten infrage, werden Experten in eigener Sache und plädieren für unsere Einzigartigkeit. Denken wir nur an den medizinischen Bereich, in dem die Deutungshoheit von Ärzten immer stärker einem kooperativen Austausch mit den Patienten weicht. Andererseits ist das Internet Quelle von Datenmissbrauch und weitreichender Eingriffe in das Persönliche, die unseren Handlungsspielraum einengen. Doch es wäre falsch, zu glauben, der Ursprung des Übels läge im Wesen des Anderen. Es ist niemand auszumachen, der uns mit vorgehaltener Pistole dazu zwingt, uns dem Technischen zu überantworten.
Der französische Soziologe und Philosoph Michel Foucault spricht in diesem Zusammenhang von der „Mikrophysik der Macht“. Nach seinen Überlegungen ist moderne Machtausübung nichts, was von außen auf uns einwirkt. Sie manifestiert sich vielmehr als Pflicht oder lustvolle Selbstdisziplinierung in unserem Inneren, die durch einen langen Prozess der gesellschaftlichen Anpassung eingeübt wird. Auch wenn es naiv ist, zu meinen, wir könnten die Parameter unserer digitalen Existenz zur Gänze frei bestimmen, so sind wir doch selbst verantwortlich, wenn wir uns öffnen und in einem Überschwang an Exhibitionismus und Gutgläubigkeit unsere Privatheit aufs Spiel setzen. Bereitwillig setzen wir unsere Daten frei, wie Duftmarken, die uns im weiten Spektrum des Digitalen auffindbar machen und uns mit dem Stigma der ständigen Verfügbarkeit versehen. Wir sind auf empfangsbereit gedrillt und sehen uns Algorithmen gegenüber, die als Handlungsanweisungen unser Leben strukturieren. In Form von Smartphones und modernen Sensortechnologien sind sie ständig an unserer Seite und treffen Entscheidungen, die wir aus Bequemlichkeit nicht mehr selbst treffen. Sie schlagen uns vor, welche Bücher wir lesen, welche Mahlzeiten wir essen und welche Menschen wir treffen sollen. Mit jeder digitalen Interaktion liefern wir Informationen, die uns in einer ganz bestimmten Weise definieren. Im Gegenzug erhalten wir Informationen, die unseren Vorlieben und Gewohnheiten entsprechen. So funktioniert beispielsweise das Geschäftsmodell von Amazon, aber auch politische Propaganda, die vage Vorstellungen durch Selbstbestätigungsprozesse in feste Überzeugungen transformiert. Die digitale Ausdeutung unserer Person macht uns vorhersehbar und befähigt diejenigen, die über unsere Daten verfügen, uns wirksamer zu manipulieren, oder positiver formuliert, ihre ökonomischen, politischen oder sonstigen Interessen mit unseren Wünschen zusammenzuführen. Indem wir Verantwortung an Binärcodes und smarte Dinge abgeben, geben wir auch ein Stück unserer Freiheit preis. Und das scheinbar ohne großen Widerwillen, da Freiheit nicht selten mit Überforderung und Unsicherheit einhergeht. So verstanden ist das Digitale auch Zufluchtsort der Entlastung, der uns mit größtmöglicher Distanz zu Aufwand und Anstrengung lockt.
Der technische Fortschritt ist ein Versprechen nach mehr. Mehr Sicherheit, mehr Lebensqualität, mehr Wohlstand, mehr Komfort, mehr Konsum. Vieles davon wurde eingelöst. Doch was unsere Individualität betrifft, unsere Freiheit, Autonomie und Privatheit, all das steht im Schein des Digitalen neu zur Disposition. Wenn jeder erdenkliche Ort zum Schauplatz digitaler Kommunikation wird, der Raum durchdrungen ist von Technologien und Dingen, die mit uns interagieren, dann bedarf es einer Neustrukturierung unseres Nachdenkens über uns selbst und unseren Platz in der Welt. Und einer Beantwortung der Frage, wie wir es schaffen, aus den technologischen Innovationen auch zukünftig soziale und gesellschaftliche Fortschritte abzuleiten.












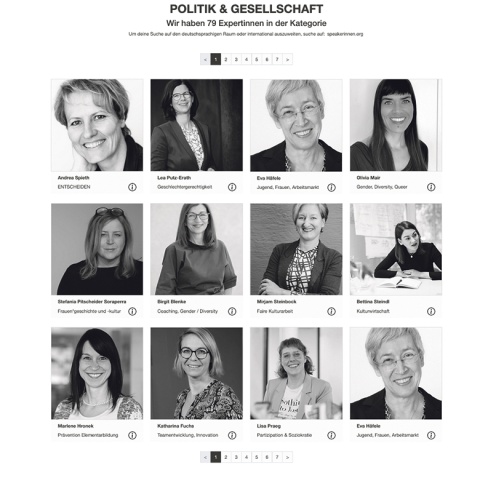

Kommentare