
Warum fällt Österreich zurück?
Dumme Frage! Klar, „weil die Steuern und die Nebenkosten zu hoch sind“, „weil die Bürokratie Initiativen erstickt“, „weil die Schulen noch nicht im neuen Jahrhundert angekommen sind“, oder das alles zusammen und einiges mehr. Ein Staat, dessen Regierung sich die Zeit mit lächerlichen Wortklaubereien vertreibt („Ist ein Zaun eine Grenzsperre oder eine technische Sicherung?“ „Obergrenze oder Richtwert?“), muss zurückfallen.
Da ist was dran. Aber sollten wir uns die Diagnose nicht gründlicher überlegen? Es geht ja immerhin um Schicksalsfragen des Landes, nicht um kräftige Behauptungen am Biertisch.
Sicher, die aktuellen Probleme sind ungewöhnlich kompliziert, sie sind miteinander ungut verwickelt und werfen lange Schatten in die Zukunft. Aber darin unterscheidet sich die Lage Österreichs kaum von der seiner Umgebung. Stimmt: Ganz Europa ist im weltweiten Vergleich zurückgefallen. Das Projekt des gemeinsamen Europas hat schweren Schaden genommen. Aber auch die sagenhaften Schwellenländer sind in eine Flaute oder gleich in eine tiefe Rezession geraten. Also sind wohl auch weltweite Probleme an der Malaise beteiligt.
Es geht hier darum, warum es unseren Partnern in der EU in den letzten Jahren gelungen ist, mit den Problemen im Durchschnitt besser fertig zu werden. Österreich, lange Zeit ein Vorzeigemodell, muss ins Stolpern geraten sein. Zwischen 2000 und 2016 hat die österreichische Wirtschaftsleistung um 24 Prozent zugenommen, die europäische nur um 18 Prozent. Aber seit 2013 muss Österreich mit 2,9 Prozent rechnen – nicht pro Jahr, sondern für drei Jahre zusammen! –, Europa immerhin um ein Viertel mehr, und Deutschland, vorher zurückgefallen, als Österreich Dynamik zeigte, wirkt als Lokomotive. Österreich erlitt keinen Totalschaden. Aber daraus könnte einer werden, wenn es nicht bald auf Kurs kommt.
Dass auch unter den gegebenen widrigen Rahmenbedingungen überdurchschnittliche Leistungen möglich sind wie in Deutschland, macht übrigens die Vorarlberger Wirtschaft vor. Das ist eher nicht ein Phänomen der Geografie, sondern eher von „nit lugg lo“. Also: in einer schwierigen Lage vorauszudenken, zuzupacken und nicht aufzugeben.
Vergangene Stärken genügen nicht
Wahrscheinlich ist das Nachlassen Österreichs teilweise die Gegenbuchung zu seinem erstaunlichen Zwischenspurt bei der Öffnung der benachbarten Märkte in Osteuropa. Die österreichische Wirtschaft hat ihre historische Chance rascher als die meisten Westeuropäer genutzt. Aber jetzt sind dort die Lücken der Nachfrage fürs Erste ausgeschöpft. Nun zeigen sich zwei Effekte: Einerseits haben manche ziemlich frech vordringenden österreichischen Unternehmen Risiken unterschätzt, zum anderen nimmt die Konkurrenz von Standorten mit geringeren Kosten zu. Es geht nicht mehr nur um attraktive Auslagerungen für supply chains. Die Lernphase haben die Ungarn, Tschechen, Slowaken, Polen und Slowenen ganz gut absolviert. Sie sind auf das Niveau mittlerer Technologien aufgestiegen und machen uns auf dieser Ebene direkt Konkurrenz.
Die Öffnung Osteuropas hat auf die österreichische Wirtschaft als Turbo gewirkt. Der Schub lässt nach und Österreich ist auf die Potenziale verwiesen, die es auch ohne Nachhilfe der Weltgeschichte schafft. Das genügt offenbar für ein Hocheinkommensland nicht. Will Österreich auf einen Spitzenplatz zurück, muss es effizienter und innovativer werden. Das gilt in erster Linie für die Rahmenbedingungen, die der Staat verantwortet, aber natürlich auch für die Wendigkeit, mit der unsere Unternehmer auf Veränderungen der Märkte und Aussichten der Zukunft reagieren.
In einer neuen Studie1) im Auftrag der EU klaubt das WIFO Österreichs Wettbewerbsstärken und -schwächen auseinander. Da sich Österreichs Industrie stark auf Investitionsgüter konzentriert, wirkt die hartnäckige weltweite Investitionsschwäche direkt und indirekt als Gegenwind für den österreichischen Export. Und außerdem ist das schwächelnde Europa nach wie vor mit Abstand der wichtigste regionale Absatzmarkt.
Die Kompetenz für Hochtechnologien beschränkt sich auf einige Segmente, etwa auf Spezialitäten im Zulieferbereich für Autos und Flugzeuge oder in Bereichen der Biotechnologien. Die führende Rolle, zu der das gut verankerte Umweltbewusstsein des Landes innovativen Umwelt- und Energietechnologien verholfen hat, hat Einbußen erlitten. In einer Woge von Turbulenzen und rasanten Umbrüchen von Märkten, Prioritäten und Technologien genüge es nicht, schreibt WIFO-Chef Aiginger, die etablierten Kompetenzfelder zu pflegen. Man müsste diversifizieren und – zweifellos riskant und teuer – in neue und kommende Schwerpunkte investieren. Das gilt vor allem für die digitale Revolution, die gerade die Welt epochal überrollt. Diese Herausforderung muss angenommen werden. Auf die müssen sich alle, die international tätig sein wollen in Entwicklung und Produktion, einstellen. Bereitschaft zu neuen Schwerpunkten ist wichtiger als Beharren und Verfeinern der bisher bearbeiteten Felder. Österreich darf gerade bei der universal einsetzbaren Digitalisierung nicht „technology follower“ bleiben, sondern muss Pionier werden und neue Nischen besetzen.
Zukunft ist nicht Science Fiction. Sie wird gemacht.
Solche Strategien sind riskant und können leicht schiefgehen. In einer Krise überwiegt ohnehin Risikoscheu. Also müssen die Risiken gestreut werden: auf die Unternehmen und auf den Staat. Letzterer ist nicht gerade für Vorausdenken bekannt.
Der Staat trägt Verantwortung für ausreichende Infrastruktur in der digitalen Epoche – nicht nur für die materielle Infrastruktur – Breitbandnetze! –, sondern ganz besonders für die immaterielle: für Bildung, für Forschung und für das Niveau der öffentlichen Diskussion.
Österreich kann sich die typische Distanz zu den Möglichkeiten der Wissenschaft nicht leisten; umgekehrt diese nicht ihre Abgehobenheit von den Sorgen der heutigen Gesellschaft. Österreich kann sich nicht leisten, öffentliche Ämter unqualifiziert zu besetzen, die Probleme der übrigen Welt erst wahrzunehmen, wenn schon Tausende Flüchtlinge die Grenzen überschreiten, und erst recht nicht, sich kein Bild zu machen davon, was es wie erreichen könnte.
Bildung ist der Systemschlüssel zur Zukunft. Gewiss wird sich die Welt ändern. Wir können das auch nur begrenzt mitgestalten. Das rechtfertigt nicht, sich zu wenig mit dem Wohin zu beschäftigen. Unsere Schulen atmen noch den Geist von gestern: Alles möge so bleiben wie es war, „wie wir’s zuletzt so herrlich weit gebracht“ haben. Österreich wird weiter zurückfallen, wenn es sich nicht ernsthaft mit dem, was wir erreichen könnten und möchten, auseinandersetzt.
1)„Deficits and Strengths in Austrian Competitiveness“ auf http://fiw.ac.at

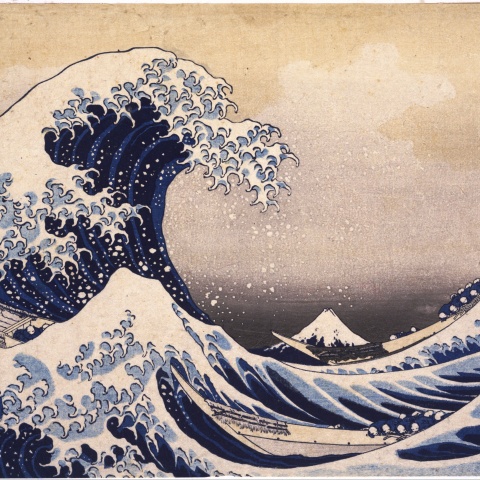











Kommentare