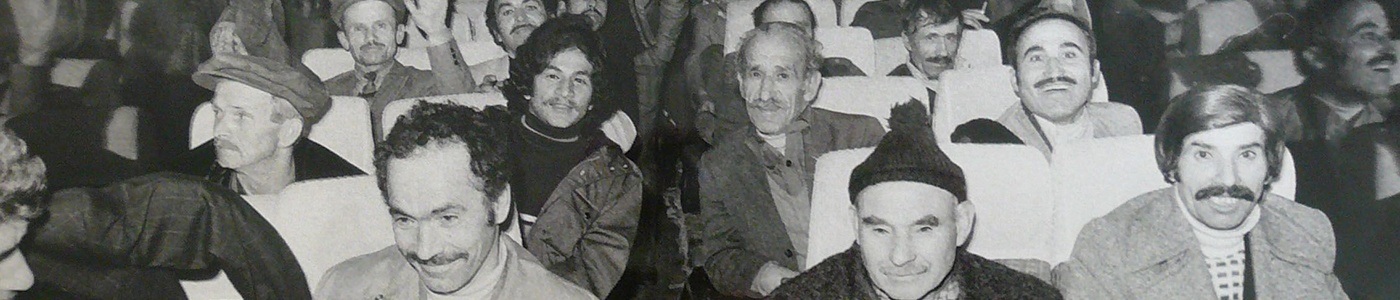

60 Jahre Anwerbeabkommen
1964 schloss Österreich ein Abwerbeabkommen mit der Türkei. Wie ist die Geschichte weitergegangen? Erinnerungsjahre stimulieren zu einordnenden Rückblicken.
Das Anwerbeabkommen zwischen Österreich und der Türkei jährte sich 2024 zum 60. Mal. Im Wirtschaftsaufschwung nach dem 2. Weltkrieg wurden zwischen zahlreichen Staaten Anwerbeabkommen für Arbeitskräfte geschlossen. Diese etablierten das „Gastarbeiter-Modell“, ein Rotationsmodell von Migration mit der Vorstellung, dass Menschen für ein paar Jahre ins Land kommen, Geld verdienen und dann wieder in ihre Heimaten zurückkehren. 1961 schloss Deutschland ein solches Abkommen mit der Türkei; 1964 folgte Österreich. 1966 schloss Österreich dann mit der ehemaligen Republik Jugoslawien das zweite Anwerbeabkommen mit nachhaltiger demographischer Wirkung. Das Rotationsmodell entsprach sehr bald nicht mehr den Bedürfnissen von Unternehmen und Zugezogenen. Heute leben in Vorarlberg über 40.000 Menschen mit familiären Wurzeln in der Türkei. Das sind rund 10 Prozent der Bevölkerung. In keinem anderen österreichischen Bundesland hat diese Gruppe diese relative Größe. Über 26.000 Menschen sind es mit Familienbezug zum ehemaligen Jugoslawien. Die Diaspora der Türkeistämmigen weltweit zählt rund sechs Millionen, der weit überwiegende Teil davon in Westeuropa lebend. In Deutschland sind es rund drei Millionen.
Erinnerungsjahre stimulieren zu einordnenden Rückblicken. Wo steht die Gruppe der Türkeistämmigen in Vorarlberg heute in ihrer sozialen Etablierung? Für Bildung, Arbeitsmarkt und Wohneigentum helfen uns Auswertungen des Mikrozensus. 2020-22 besuchten rund 30 bis 40 Prozent der 2. Generation Türkeistämmiger zwischen 15 und 19 Jahren eine Matura-führende Schule. Rund 40 bis 50 Prozent machten eine Lehre oder besuchten eine berufsbildende mittlere Schule. Rund 20 Prozent hörten nach der Pflichtschule auf. Die Vergleichsgruppe Jugendlicher mit Eltern aus Österreich erzielte höhere Bildungsabschlüsse. An diese haben die jungen Vorarlberger und Vorarlbergerinnen mit Eltern aus der Türkei noch nicht angeschlossen. Verglichen mit den Bildungsabschlüssen der 1. Generation sind die Entwicklungen jedoch markant: Rund 80 Prozent der Väter und Mütter der 1. Generation hatten nach einer repräsentativen Befragung von 2008 keine über die Pflichtschule hinausgehende Ausbildung; rund 45 Prozent hatten ihre Bildung sogar bereits nach einer 5-jährigen Grundschule abgeschlossen. Die vor-anschreitende strukturelle Integration der Türkeistämmigen im Land zeigt sich auch an der Positionierung auf dem Arbeitsmarkt. 65 Prozent der (männlichen) Vorarlberger mit Eltern aus der Türkei waren 2020-22 „qualifiziert“ beschäftigt (also nicht in Hilfs- oder Anlerntätigkeit); sogar 70 Prozent waren es bei den Frauen dieser Gruppe. In der Elterngeneration war das Bild noch ein gänzlich anderes. Der Arbeitsmarktintegration von Frauen gilt gerne besondere Aufmerksamkeit, vor allem, wenn die Zugewanderten aus Ländern mit traditionellen Familienvorstellungen kommen. Heute sind rund 70 Prozent der Frauen in Vorarlberg mit Eltern aus der Türkei, also der 2. Generation, erwerbstätig. Von den Frauen mit Eltern aus Österreich sind es 88 Prozent. Von den Frauen der 1. Generation aus der Türkei sind jedoch lediglich an die 45 Prozent erwerbstätig. Die Entwicklungen zeigen also einen klaren Trend. Interessant sind auch die Etablierungstrends beim Wohneigentum. Rund 40 Prozent der 2. Generation lebt bereits in Eigentum (Trend steigend). Zum Vergleich: Von der Gruppe mit Eltern aus Österreich wohnen circa 73 Prozent in Eigentum (Trend leicht fallend). Die Daten zeigen aber auch, dass Türkeistämmige in Vorarlberg nach wie vor deutlich öfter zu sozial ungünstigen Arbeitszeiten arbeiten als beispielsweise Beschäftigte mit Eltern aus Österreich. Sie leisten also Schichtarbeit und/oder arbeiten wiederholt an Samstagen, Sonntagen, Abenden oder in der Nacht. Türkeistämmige Vorarlberger zeigen sich mittlerweile auch in den politischen Gremien Vorarlbergs. 40 Prozent der Kandidatinnen und Kandidaten auf den Listen der Arbeiterkammer hatten 2019 familiäre Bezüge zur Türkei, und 16 Prozent waren es bei den Mandatträgern. Auch in Gemeindevertretungen und im Landtag zeigen sie seit ein paar Jahren zunehmend Präsenz.
Mit dieser Entwicklung folgt die Integration der Türkeistämmigen im Land einem international und historisch gut belegten Trend. Auf längere Sicht gelingt die Integration, auch wenn die Probleme der ersten Jahrzehnte groß sein können und kleinere Teilgruppen teilweise länger brauchen. Zu einem Rückblick gehört aber auch das Identifizieren noch „offener Baustellen“. So könnte in Teilgruppen der Türkeistämmigen der frühe Deutscherwerb bei Kindern stärker familiär gestützt werden. Die ausgeprägte Vereinsstruktur (vor allem Moscheevereine) wäre eine starke Ressource für eine Sensibilisierung in den Familien. In der Vorarlberger Mehrheitsgesellschaft sollten Minarette als sichtbare Zeichen, dass im Land nun auch Muslime leben und dazu gehören möchten, ihren Provokationscharakter verlieren. Nicht solche sichtbaren Zeichen sind das Problem, sondern einzelne ideologische Strömungen, die den europäischen Säkularismus und Laizismus ignorieren beziehungsweise zu unterhöhlen versuchen.
Vorarlberger ohne Migrationsgeschichte könnten sich auch in mehr Verständnis für die „Zweiheimischkeit“ von Menschen mit Migrationsgeschichte üben. Für diese ist eine solche Identität auch generationenübergreifend quasi „Normalität“ und keine Absage an die Loyalität für das neue „Heimatland“. Zugleich müssen Türkeistämmige verstehen, dass kritische und besorgte Fragen nach dem Demokratieverständnis je nach politischen Entwicklungen im Herkunftsland keine Zumutung sind, sondern auch quasi „normal“ und berechtigt. Immerhin tragen wir gemeinsam Verantwortung für Gegenwart und Zukunft dieses Lebensraumes.








Kommentare