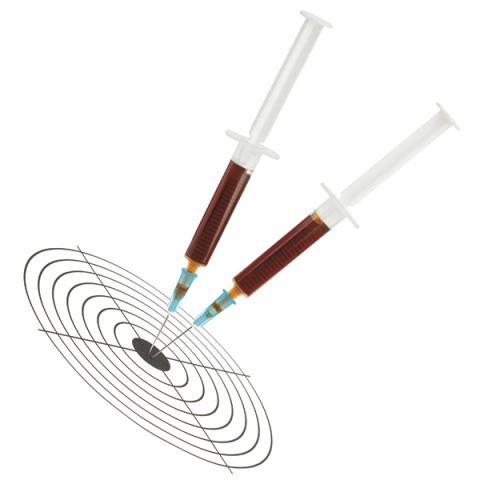
Machtspiele um die Gesundheit
Wieder einmal wird ein Versuch unternommen, eine Gesundheitsreform zu stemmen. Und wieder einmal gibt es handfeste Konflikte zwischen den Ärzten und den Krankenkassen. Eine Analyse, worum es wirklich geht.
Die Ausgangslage ist nahezu unbestritten: Im heimischen Gesundheitswesen wird viel Geld unsinnig ausgegeben. Nicht dass das System zu teuer wäre – mit rund elf Prozent der Wirtschaftsleistung liegt man zwar international im Spitzenfeld, aber deutlich hinter der Schweiz und Deutschland. Auch die Krankenkassenbeiträge sind mit 7,65 Prozent der Lohnkosten vergleichsweise niedrig. Zum Vergleich: in Deutschland zahlen Dienstnehmer und Dienstgeber beinahe das Doppelte. Und die Kassenbeiträge sind hierzulande in den vergangenen 25 Jahren auch konstant geblieben, während etwa in Deutschland gerade wieder über eine Erhöhung diskutiert wird.
Doch die guten Zahlen täuschen. In der angestellten Rechnung ist in Österreich – im Gegensatz zu unseren Nachbarländern – ein Bereich nur teilweise eingerechnet: jener der Spitäler. Denn die zahlen vor allem Länder und Gemeinden. Und zwar aus dem Steuertopf. Denn die Krankenkassen zahlen nur einen gedeckelten Pauschalbetrag für die Krankenhäuser. Im Jahr 1997, als die letzte große Gesundheitsreform in Angriff genommen wurde, wollten das die Länder so. Immerhin sind Spitäler wichtige regionale Arbeitgeber und bieten damit Platz für politische Spielräume. Doch allmählich wird den Ländern diese Spielwiese zu teuer.
Denn nicht nur die Politiker liebten die Spitäler und bauten sie im Stil von Denkmalerrichtern regelmäßig aus, auch die Patienten schätzen sie – hat man ihnen die Kliniken doch immer als manifeste Symbole einer hervorragenden Versorgung angepriesen. Die Folge ist eine im internationalen Vergleich enorm hohe Spitalshäufigkeit der Bevölkerung. „Wir haben hier insgesamt eine angebotsinduzierte Nachfrage“, sagt der aus Bregenz stammende Gesundheitsexperte und Wissenschaftliche Leiter des Wiener Instituts für Gesundheitsforschung, Wolfgang Dür. Angebotene Gesundheitsleistungen würden nachgefragt. „Wir haben erhoben, dass dort, wo die Ärzte- und Spitalsdichte am höchsten ist, die Menschen auch am ungesündesten sind. Auch das subjektive Empfinden der Menschen ist so. Eigentlich würde man das Gegenteil vermuten, nämlich, dass in unterversorgten Gegenden die Menschen kränker sind.“
Gibt es ein Spital, wird es genutzt –nicht zuletzt auch, weil es im Gegensatz zum niedergelassenen Bereich ständig verfügbar ist. Das soll sich nun aber ändern. Die Gesundheitsministerin und die Länder haben sich darauf verständigt, sogenannte Primärversorgungszentren zu forcieren, wo Allgemeinmediziner mit anderen Gesundheitsberufen zusammenarbeiten und es längere Öffnungszeiten gibt. Damit sollen teure Spitalsambulanzen entlastet werden. Die Idee ist nicht neu, stößt aber bei den Ärzten auf Skepsis. Mehr noch: Was schon die Vorgängerinnen von Sabine Oberhauser – Andrea Kdolsky und Maria Rauch-Kallat – zu spüren bekamen, beschäftigt nun auch die aktuelle Gesundheitsministerin: Die schon von ihren Vorgängerinnen geplanten niedergelassenen Gesundheitszentren lassen die Ärzte auf die Barrikaden gehen. Man fürchtet den Verlust der Autonomie und des eigenständigen, freiberuflichen Arztes auf Kosten von unternehmerisch geführten Zentren. Dahinter steht aber vor allem ein Tarifkonflikt.
Was heikler ist …
Die neuen Primärversorgungseinheiten sollen zusätzlich zu den bestehenden Hausärzten kommen, es soll keinen Eingriff in bestehende Vertragsverhältnisse und keinen Zwang zum Umstieg geben, sondern Anreize. Bereits bestehenden Arztpraxen mit Kassenvertrag ist der Vorzug zu geben. Heikler ist, dass zwar ein neuer, bundesweit einheitlicher Gesamtvertrag vorgesehen ist, der die Grundzüge regeln soll. Dazu soll aber die Sozialversicherung Einzelverträge mit jeder Primärversorgungseinheit abschließen. Die Ärzte vermuten, dass man einen neuen Gesamtvertrag für die Primärversorgung unter Ausschluss der Ärztekammer machen will und damit die einzelnen Ärzte ohne Schutz der Kammer dastünden. Anders formuliert: Die Ärzte laufen nicht gegen das geplante Gesetz Sturm, sondern kritisieren Passagen, die gar nicht im geplanten Gesetz stehen – eben weil sie nicht drin stehen.
„Für uns Ärzte macht es die Situation schwierig“, schreibt der Kurienobmann der Vorarlberger Ärztekammer, Burkard Walla, in einem Schreiben an seine Kollegen. „Man wird wieder versuchen, uns ins Eck der Generalverhinderer und Blockierer zu stellen, wobei das auf der Sachebene gar nicht sein müsste. Neue vernetzte Versorgungsformen könnten als Ergänzung des bestehenden Systems tatsächlich in manchen Bereichen den Versorgungsbedarf gut und vielleicht sogar besser abdecken.“ Das Problem aus seiner Sicht: „Ich hoffe, dass auch die Öffentlichkeit versteht, was für eine tiefgreifende Veränderung hier stattfinden soll und dass es einen Angriff auf ein etabliertes System bedeutet, weil Kollektivverhandlungsmöglichkeiten gegenüber einem mächtigen Monopolfinanzierer (Staat und Kassen) ein wesentliches Prinzip sind.“
Kuriose Situation
Damit bringt der Arzt ein Generalproblem des Gesundheitswesens auf den Punkt: die kuriose Situation der niedergelassenen Ärzte. Kollektivverhandlungen kennt man primär aus der Sozialpartnerschaft. Doch die niedergelassenen Ärzte sind selbstständige Unternehmer, die meist auf ihre Freiberuflichkeit pochen, wie sie auch Architekten, Notare, Rechtsanwälte und andere haben. Die allerdings haben keinen zentralen Auftraggeber, der ihnen einen nahezu unkündbaren Honorarvertrag gibt. Die Ärzte mit Kassenvertrag schon. Ein Kassenfunktionär beschreibt das hinter vorgehaltener Hand so: Die Ärzte seien Freiberufler mit unkündbarem Beamtenstatuts.
Zu kurz kommen bei all diesen Konflikten die Patienten, kritisiert Dür. Der Vorteil der Primärversorgungszentren sei die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Hier gehe es nicht um Polykliniken, wie es sie einst in Osteuropa gegeben habe, sondern eine optimale Versorgung im niedergelassenen Bereich. „Hier geht es um ein ökonomisches Argument. Die Ärzte wollen das weiterhin steuern.“ Dür sieht ein weit größeres Potenzial zur besseren Versorgung in der Telemedizin und der ab Ende 2016 in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg geplanten 24-Stunden-Telefonhotline für medizinische Fragen. Der Service läuft über Notleitstellen. „In der Schweiz gibt es das schon. Dort zeigt sich, dass 40 Prozent der Anrufe von besorgten Müttern kommen. Der Großteil der Fragen kann telefonisch geklärt werden, ohne dass ein Arzt oder gar ein Krankenhaus aufgesucht werden muss.“ Die Ärzte sehen die Pläne derzeit skeptisch.













Kommentare