
„Diese toten Winkel unserer Welt“
Libyen, Kongo, Sudan, Irak: Fotojournalistin Julia Leeb reist an die gefährlichsten Orte dieser Welt, um jene sichtbar zu machen, die ansonsten im Dunkeln bleiben. Sie hat Schreckliches gesehen und Schreckliches erlebt, hat auf ihren Reisen aber auch viel Menschlichkeit gefunden. Im Interview sagt die Deutsche: „Auch wenn dieses ewige Kämpfen, Töten, Rächen wie ein Fluch auf uns Menschen liegt, ist letztlich das Licht stärker als die Dunkelheit.“ Ein Gespräch mit einer mutigen Frau über die Macht von Bildern, über lebensgefährliche Situationen – und „ein Leben an den Brennpunkten dieser Welt“.
Frau Leeb, Sie reisen an Orte, an die sich sonst kaum ein Mensch traut. Warum?
(längere Pause) Weil es mir ein Anliegen ist, die Welt, auf der ich lebe, zu verstehen.
In welchem Teil der Welt waren Sie denn zuletzt?
Ich war im Juni im Irak, in diesem leidgeprüften Land, in dem Gewalt in den verschiedensten Formen immer wieder auftaucht. Aber ich habe im Irak ein sehr diverses Umfeld vorgefunden und wunderbare Bekanntschaften machen können. Es war eine eindrucksstarke Reise nach Bagdad, die mich sehr viel gelehrt hat.
Und wohin führt Sie Ihre nächste Reise?
Das kann ich aus Sicherheitsgründen nicht sagen. Ich reise in ein Gebiet, in dem es viele Entführungen gibt, da wäre es äußerst unklug, wenn man sich ankündigt.
Wer das macht, was Sie machen, braucht Mut. Sehr viel Mut.
Ich weiß nicht, ob ich so mutig bin. Ich habe so viele Ängste mit anderen Sachen (lacht). Mut ist vielschichtig. Angst auch. Manchmal muss man die Angst besiegen, manchmal ist die Angst auch ein sehr wichtiger Ratgeber. Es ist ein steter Interessenskonflikt, weil das, was ich wissen will, oft hinter der Angst liegt.
Sie schreiben in Ihrem berührenden Buch: „Ich reise diesen Nicht-Bildern hinterher. Ich möchte diese Lücken füllen und diese toten Winkel unserer Welt beleuchten.“
Man sieht immer nur die, die im Licht sind. Man sieht nur die, die online sind. Es werden weltweit Milliarden von Fotos gepostet. Aber wo sind die Fotos beispielsweise aus dem Jemen? Oder aus Somalia? Wer in dieser großen, vielfältigen Welt in einer Diktatur lebt, kann nicht einfach mal so seine Meinung kundtun oder einen Instagram-Post hochladen. Und wir? Wir sehen diese Menschen nicht. Sie wissen alles über uns und wir wissen noch nicht einmal, dass sie überhaupt existieren. Doch wenn Unrecht unsichtbar bleibt, dann wächst es sich zu einem unberechenbaren Monster aus. Aus diesem Grund muss man in diese toten Winkel unserer Welt schauen.
Wie kam es eigentlich zum Wunsch, ein „Leben an den Brennpunkten dieser Welt“ zu leben, wie Sie das selbst beschreiben?
Die Welt in ihrer Vielseitigkeit hat mich einfach immer interessiert, all diese verschiedenen Kulturen und Regionen und Länder. Ägypten beispielsweise war vor tausenden Jahren eine Hochkultur, heute ist davon nicht mehr so viel übrig. Aber vielleicht sind sie uns ja nur schon voraus. Wer weiß denn, wo wir beispielsweise in einhundert Jahren sind. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle im gleichen Spiel sind, nur auf verschiedenen Ebenen. Wir alle leben im ewigen Rhythmus von Rück- und Fortschritt, heute sind es die und morgen sind es wir. Und im Übrigen, das ist meine Erfahrung, sind wir alle uns viel ähnlicher, als wir immer denken.
Sie sagen von sich selbst, sie hätten „den naiven Anspruch“, mit Ihren Bildern die Welt zu verändern.
Ich glaube nicht, dass ich die Welt als Ganzes verändern kann, natürlich nicht. Aber ein jeder von uns hat Gestaltungsmöglichkeiten und ein jeder kann konkret etwas tun. Jeder Mensch kann einem anderen Menschen helfen.
Haben Bilder Macht? Die Macht, Dinge zum Besseren zu verändern?
Ich habe früher einmal im Auswärtigen Amt in Italien gearbeitet. Es gab viel Schriftverkehr. Aber die Menschen wurden dadurch nicht erreicht. Und irgendwann habe ich dann verstanden, wie schnell Kommunikation ist, wenn sie visuell ist. Man braucht keine Übersetzung. Die Bilder sprechen eine universelle Sprache. Und sie besitzen eine unglaubliche Macht, weil sie verändern können, wie wir über Menschen denken, weil sie verändern können, wie wir über Menschen reden. Und weil sie verändern können, wie wir handeln. Und so schaffen es manche Bilder auch, in das kollektive Bildgedächtnis einzugehen.
Es gibt Bilder, die Wendepunkte wurden, die die Weltsicht veränderten, etwa das Bild des kleinen Mädchens nach einem Napalm- Angriff in Vietnam …
Das ist ein zeithistorisches Bild, fotografiert von Nick Ut. Ich verwende das immer als Referenz, weil es das Bild ist, das die Amerikaner zum Umdenken gebracht hat. Dieses Bild hat nichts anderes gezeigt als das, was Krieg ist. Und es ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man an das Gute der Menschen appellieren kann, wenn man die Wahrheit zeigt.
Können Bilder auch heute noch den Lauf der Geschichte ändern?
Ich kann ein konkretes Beispiel nennen. Diesen Angriff in Libyen, da habe ich den Mord an Zivilisten fotografiert, festgehalten. Diese Bilder wurden publiziert, das Bundeskriminalamt kam zu mir, ich musste aussagen. Wäre Gaddafi lebendig gefangen genommen worden, hätte der Internationale Strafgerichtshof diese Bilder im Prozess verwendet. Bilder haben eine unglaubliche Macht. Das wissen auch die Machthaber in solchen Gegenden. Deswegen gibt es ja momentan einen so vehementen Krieg gegen Journalisten.
Einen Krieg gegen Journalisten?
Jedes Jahr gewinnt ein Journalist den Pulitzer-Preis für Auslandsberichterstattung und über hundert werden eingesperrt oder umgebracht.
Sie sagen an einer Stelle in Ihrem Buch, Sie hätten immer schon mit einem Gefühl der latenten Bedrohung zur Kamera gegriffen. Ein Gefühl der latenten Bedrohung? Warum?
Das ist eine gute Frage (längere Pause). Ich glaube, das liegt daran, dass der Krieg eben nicht mit der letzten Bombe aufhört. Manchmal lebt er geräuschlos weiter in den Menschen, auch in den Nachkommen. Den Kindern erzählt man das nicht. Wie denn auch. Wie kann man auch einem Kind Krieg erklären? Oft gab und gibt es deshalb das große Schweigen. Aber diese Energien bleiben, sie sind eine Art von Kommunikation, ein lautloser Informationsaustausch.
Und die Kamera?
Die Kamera ist ein wunderbares Instrument, weil man mit ihr die Zeit anhalten und ein Dokument schaffen kann, das echt ist, das existiert, das man einem nicht mehr nehmen kann. Die Kamera ist das einzige Instrument, das das schonungslose Verfließen von Zeit aufzuhalten vermag; mit ihr kann man die Welt für einen Augenblick stoppen, das Leben kurz anzuhalten, den Moment einfrieren.
Sie wollen mit der Kamera die Zeit einfrieren.
Ja. Das hat für mich auch etwas wahnsinnig Beruhigendes. Der Akt des Fotografierens bedeutet für mich, Kontrolle über etwas Unkontrollierbares auszuüben. In dem Moment, in dem ich in einer gefährlichen Situation fotografiere, habe ich das Gefühl, ich könnte etwas kontrollieren, was ich in Wahrheit natürlich nicht kontrollieren kann. Bei diesem Angriff in Libyen habe ich nicht fotografiert, weil ich die Bilder anschließend publizieren wollte. Ich habe damals nicht gedacht, dass ich aus dieser Situation lebendig herauskomme. Es war vielmehr ein verzweifelter Akt, Kontrolle auszuüben.
Was ist damals in Libyen passiert?
Es war der 14. März 2011, der Tag, an dem die Situation in Libyen zum Krieg mutiert ist und wir in einen Hinterhalt geraten sind. Wir waren auf dem Weg nach Brega, ein paar Autos hatten uns eben überholt, die Insassen hatten uns noch zugewunken. Wir blieben kurz stehen, nur durch einen Zufall. Doch dieser Zufall hat mir das Leben gerettet. Als wir wieder losfuhren, sah ich ausgebrannte Autos. Ich stieg aus und habe einen Moment gebraucht, bis ich verstanden habe, dass das die Fahrzeuge waren, die uns eben erst überholt hatten. Da wurde mir schlagartig bewusst, dass auch ich im Visier von Gaddafis Truppen stand. Und als ich das realisiert hatte, da schlug auch schon eine Granate in unserem Auto ein.
Eine Granate?
Das Fahrzeug explodierte, ein Freund starb, ich bin weggerannt, zunächst noch mit erhobenen Händen, weil ich in dem Moment immer noch gedacht habe, es handle sich um eine Verwechslung. Aber das war keine. Die wollten die Zeugen ausschalten. Ich schaffte es, hinter eine Düne zu springen und dort in Deckung zu gehen. Das war der Beginn eines langen, langen Überlebenskampfes. Stundenlang schlugen Granaten ein, ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich da nicht mehr lebendig herauskomme. Aber ich habe es geschafft, musste ausharren, bis die Nacht anbrach und bin dann geflohen.
Sie schreiben, diese Nacht habe alles verändert. Sie seien danach nie wieder diejenige gewesen, die Sie zuvor waren.
Das ist so. Es kann jeder Überlebende einer solchen Situation wahrscheinlich bestätigen, dass die Angst danach ein Eigenleben annehmen kann. Die Angst wird zu einem Begleiter, man ist ein anderer Mensch. Aber man sieht das Ganze auch mit einer sehr großen Demut und Dankbarkeit. Ich habe das größte Geschenk bekommen, das ein Mensch bekommen darf: Ein zweites Leben. Das Wissen um die Endlichkeit des Menschen macht einen demütig. Und ein bisschen Demut ist ganz gesund.
Wird man denn diese – inneren – Bilder jemals wieder los?
(Pause) Ich arbeite an diesen Bildern. Würde ich das nicht machen, würden diese Bilder an mir arbeiten.
Sie waren ein Jahr später wieder in Lebensgefahr, gerieten im Zuge der ägyptischen Revolution am Tahir-Platz in die Fänge eines Mobs. Ein später im Internet veröffentlichtes Video zeigt, wie Sie verschleppt werden …
Ja. Das war am 11. Februar 2012. Böse Menschen wollten mich zum Schweigen bringen, weil ich eine Frau und eine Journalistin bin. Eine Frau im öffentlichen Raum, gerade in diesen patriarchalen Gebieten, hat eigentlich eine ähnliche Funktion wie eine Journalistin: Sie dient als Korrektiv. Männer verhalten sich anders, wenn Frauen oder Journalisten da sind. Das wollten sie damals aber nicht. Deswegen wurde ich angegriffen. Die haben mich gezielt ausgesucht, die haben meinen Körper geschunden, die wollten mich auslöschen. Aber das haben sie nicht geschafft. Mein Körper war verletzt, aber ich habe die Entscheidung getroffen, dass diese Menschen keine Kontrolle über mein Innenleben bekommen werden. Deswegen habe ich eigentlich keine Erinnerungen an diesen Vorfall. Wenn ich diese Bilder anschaue, dann ist das eine fremde Person, die ich da sehe.
Die Nacht, heißt es in Ihrem Buch, sei Ihre größte Feindin geworden. Die Nacht? Warum?
Für die meisten Menschen, davon gehe ich zumindest aus, ist die Nacht eine Zeit, in der sie sich erholen können. Bei mir ist das nicht so. Die Nacht hat für mich eher etwas mit Kämpfen zu tun. Während andere schlafen, fangen meine Kämpfe an. Im Übrigen hat man in Krisengebieten großen Respekt vor der Dunkelheit. Der Mensch in der Masse verändert sich, und der Mensch in der Dunkelheit auch. Die Nacht verändert das Wesen der Menschen.
Können wir auch über folgendes Zitat von Ihnen sprechen? „Vor Ort frage ich mich oft, ob Männer und Frauen einen unterschiedlichen Blick auf die Welt und auf Kriege haben.“
Ich gehe da nur von meinen eigenen Beobachtungen aus, da hat es sich gezeigt, dass männliche Kollegen eher anders auf Kriege schauen. Da fokussiert sich die Kriegsberichterstattung auf die Zerstörer, man redet sehr technisch über Krieg. Alles hat Bezeichnungen, Opfer werden als Kollateralschäden bezeichnet. Anja Niedringhaus, die leider nicht überlebt hat, war eine wunderbare Kriegsfotografin. Anja hat viel langfristiger gearbeitet als viele männliche Kollegen, sie hat es immer geschafft, auch Menschliches zu zeigen. Zu zeigen, was der Krieg mit den Menschen macht.
Ihr Buch heißt „Menschlichkeit in Zeiten der Angst“. Haben Sie denn auch in diesen schrecklichen Gebieten, in diesen schrecklichen Zeiten Menschlichkeit gefunden?
Ja. Und das ist das Wunderbare. Denn es gibt eben auch eine andere Seite des Krieges und des Konflikts, und das sind die Menschen, die aufrechterhalten, aufbauen, vergeben, sich uneigennützig um andere kümmern. Und das sind oft Frauen. Diese Menschen haben aber fast nie die Sichtbarkeit erfahren, die ihnen gebührt. Ich will das ändern, ich will ihnen ein Bild geben, eine Stimme geben. Ich habe auf meinen Reisen sehr, sehr viel Menschlichkeit erfahren. Das ist ein Trost. Ich glaube daran, dass das Gute siegen wird. Nicht unmittelbar, aber langfristig.
Sie erhalten sich diesen Optimismus, trotz all der Schrecken, die Sie gesehen, trotz all der Schrecken, die Sie fotografiert haben?
Ja. Weil mir diese guten Menschen begegnen. Und wenn diese Menschen nicht den Traum verlieren, dass es eine gute Zukunft geben kann, dann kann ich auch nicht daran zweifeln.
Ja? Kann man, wenn man all das Elend, das Grauen und diese Grausamkeiten sieht, überhaupt noch an das Gute im Menschen glauben? Oder ist letztlich „der Mensch dem Menschen ein Wolf“ und nichts anderes, um Hobbes zu zitieren?
Nein, daran glaube ich nicht. Auch wenn dieses ewige Kämpfen, Töten, Rächen wie ein Fluch auf uns Menschen liegt, glaube ich, dass es mehr gute als schlechte Menschen gibt. Ich glaube an die Kraft und Gestaltungsmöglichkeit eines jedes Einzelnen. Ich habe wunderbare Menschen kennengelernt und weiß, dass sie langfristig diesen Kampf gewinnen werden. Denn das Licht ist stärker als die Dunkelheit.
Vielen Dank für dieses Gespräch!
Lesetipp!
Julia Leeb, „Menschlichkeit in Zeiten der Angst. Reportagen über die Kriegsgebiete und Revolutionen unserer Welt“, mit vielen Fotos, Suhrkamp, Berlin 2021 .













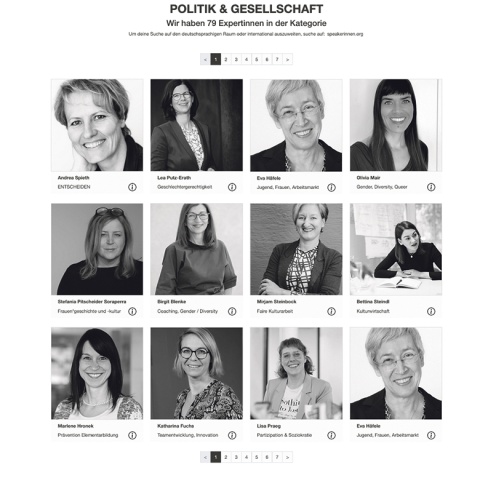

Kommentare