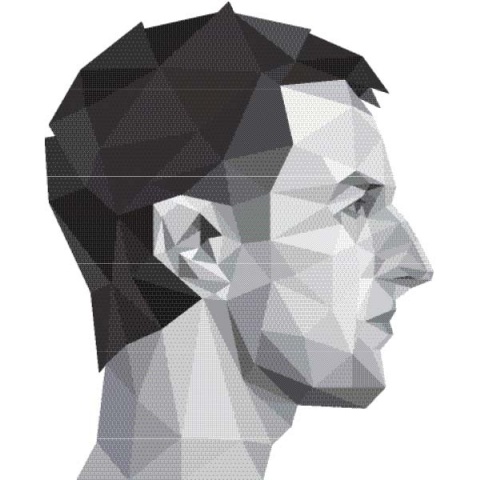
Generation Y – anders leben, anders arbeiten, anders sein
Jede Generation ist mit Vorurteilen und Kritik der vorangegangenen Generationen konfrontiert. Ein besonders eisiger Wind schlägt der sogenannten Generation Y entgegen. Da ist die Rede von der Generation der Verwöhnten, der Unpolitischen, der Spaßorientierten. Autorin Kerstin Bund – selbst eine „Ypsilon“ – hält dagegen: „Wir wollen arbeiten. Nur anders.“
Digital Natives, Nexters, Millennials – für die sogenannte Generation Y gibt es viele Bezeichnungen. Gemeint ist damit die Generation der zwischen 1980 und 1995 Geborenen. Das „Y“ steht für „Why?“, also „Warum?“, weil es im Englischen gleich ausgesprochen wird und diese Frage das Leben der heute 19- bis 34-Jährigen maßgeblich bestimmt. Neben diversen Namen mangelt es aber auch nicht an Vorurteilen: Die Generation Y wird als angepasst, harmlos, konturlos und verwöhnt kritisiert. Sie ist dem Vorurteil ausgesetzt, unentschlossen durch die moderne Gesellschaft der vielen Möglichkeiten zu stolpern. Ihre Großeltern wuchsen in den Jahren während und nach dem Zweiten Weltkrieg, in Zeiten größter Not und Entbehrungen auf, ihre Eltern sind „Baby Boomer“, für die Selbstdisziplin und Pflichterfüllung eine große Rolle spielen. Ist es das Problem der Generation Y, dass sie eine Generation ohne Probleme ist?
Der Sozial-, Bildungs- und Gesundheitswissenschaftler Klaus Hurrelmann sagt in einem „Kurier“-Interview: „Sie wissen, dass die Welt von morgen wieder ganz anders aussehen kann. Sie vertrauen auf nichts, für alles, was sie tun, gibt es noch eine Option B, C oder D.“ Ypsilons haben keinen festen Plan und zelebrieren Flexibilität geradezu. Das ist in Zeiten großer Unsicherheit nicht weiter verwunderlich. Auf eine Wirtschaftskrise folgt die nächste, die Lebenshaltungskosten steigen, leistbares Wohnen rückt ebenso in weite Ferne wie sichere Pensionen. Das Hinterfragen von Familie, Arbeit und Politik gehört zum Bild dieser Generation wie das Akzeptieren der Tatsache, dass das Wohlstandsniveau der Eltern nur schwer erreichbar sein wird. „Irgendwie glauben sie, dass sie durchkommen, weil die meisten auch als Erwachsene auf die Unterstützung der Eltern setzen können“, sagt Hurrelmann.
Für Firmenchefs und Personalverantwortliche ist das Strömen der vielen tausend „Ypsiloner“ auf den Arbeitsmarkt eine dementsprechend große Herausforderung, haben sie es doch nun mit Menschen zu tun, die eine ganz andere Vorstellung von der Lebens- und Arbeitswelt mitbringen. „Wir sind eine verwöhnte Generation, aber wenn man uns richtig führt, sind wir extrem leistungsbereit. Nur müssen Chefs wissen, wie sie uns motivieren. Mit den alten Insignien der Macht können wir zum Beispiel wenig anfangen“, erklärt Kerstin Bund, Journalistin und Autorin. Im Untertitel ihres Buchs „Glück schlägt Geld“ schreibt sie „Generation Y: Was wir wirklich wollen“ und schaffte es damit auf die Shortlist des Deutschen Wirtschaftsbuchpreises. Sie stellt klar: „Wir sind weder faul noch größenwahnsinnig. Wir wollen anders leben und anders arbeiten.“ Ihre Generation wünsche sich eine „echte Balance zwischen Arbeit und Privatleben, wir wollen uns nicht zwischen Kindern und Karriere entscheiden müssen“.
Generationenkonflikt am Arbeitsmarkt
Durch die Generation Y vollzieht sich also nicht nur ein gesellschaftlicher Wandel, auch die Berufswelt wird einigermaßen auf den Kopf gestellt. „In den meisten Unternehmen sind heute drei Generationen – Baby Boomer (bis 1964 Geborene), Generation X (Jahrgänge 1965 bis 1979) und eben die Generation Y – beschäftigt, doch in den wenigsten findet man sie gemeinsam bei der Arbeit“, sagt Trendforscherin Birgit Gebhardt. Sie hat analysiert, dass dieser Generationenkonflikt nicht aus einem unterschiedlichen Kommunikations- und Medienverhalten, sondern aus der differierenden Auffassung von Arbeit resultiert. Dabei könnte „der Generationenkonflikt für die vernetzte Arbeitskultur sogar eine treibende Funktion übernehmen, wenn er produktiv verwandelt wird“, stellt Gebhardt in Aussicht. Und was kommt dann? Die nächste Generation, also Z, steht schon in den Startlöchern. Schreibmaschinen oder ein Telefon mit Wählscheibe kennen sie nur noch aus dem Museum. Noch bleibt abzuwarten, ob die „Z’s“ von den vorangegangenen Generationen für ihre Angepasstheit oder ihre Rebellion kritisiert werden.














Kommentare