
Klimatisch aufgewärmt, politisch abgekühlt
Vor weniger als einem Jahrzehnt galt Klimaschutz als das politische Megathema. Schulstreiks, „Fridays for Future“ und ausgerufene Klimanotstände bestimmten den öffentlichen Diskurs. Eine „Klimakatastrophe“ oder gar die „Klimaapokalypse“ drohe, so die Warnungen. Die Erderwärmung müsse dringend unter 1,5°C, jedenfalls aber unter 2,0°C bleiben.
Währenddessen stiegen die weltweiten Emissionen unaufhaltsam weiter, ebenso die Durchschnittstemperatur, die im Jahr 2024 bereits bei 1,6°C über dem vorindustriellen Niveau lag. Die Reaktion darauf? Jedenfalls keine Schulstreiks mehr. Eher werden Klimaschutzanstrengungen skeptisch gesehen, teils verspottet.
Warum Klimaschutz scheitern musste
Zwei grundlegende Aspekte typisch menschlichen Verhaltens machen deutlich, warum individuelle oder nationale Klimaschutzbemühungen kaum je Aussicht auf Erfolg im Kampf gegen die Erderwärmung haben können:
Die Zeitdimension. Wirksame Maßnahmen zur Senkung von Emissionen verursachen Kosten – und zwar sofort. Ihr möglicher Nutzen hingegen liegt Jahrzehnte in der Zukunft und ist unsicher. Das macht effektiven Klimaschutz unattraktiv, denn im Normalfall lieben Politiker eher Entscheidungen, die sofortigen Nutzen versprechen, während Kosten in die Zukunft verschoben werden.
Weltweiter Nutzen, persönliche Kosten. Der Nutzen von Emissionsreduktionen verteilt sich weltweit. Die Kosten hingegen tragen allein jene Länder, die versuchen, ihre Emissionen zu senken. Dabei haben sie keine Garantie auf eine Gegenleistung. Ähnlich gilt: Wer auf Konsum oder Mobilität verzichtet, trägt persönliche Kosten für einen Klimaschutzeffekt, der weltweit verstreut und damit individuell im Grunde nicht spürbar ist. In der Regel streben Menschen nach persönlichem Nutzen und möchten am liebsten, dass andere die Kosten tragen.
Diese beiden Aspekte zeigen, dass Klimaschutz nur unter sehr spezifischen Voraussetzungen dauerhaft und effektiv möglich ist – etwa bei verbindlichen, langfristigen Zusagen möglichst aller Länder der Welt. Doch genau daran scheitert es: Zwar werden Klimaverträge unterzeichnet, doch viele der unterzeichnenden Staaten sind autoritäre Regime, denen internationale Verpflichtungen wenig bedeuten. Und selbst Entscheidungsträger in liberalen Demokratien handeln oft nach innenpolitischem Kalkül, wie mitunter die Politik der USA zeigt.
Und doch war Klimaschutz über einige Jahre hinweg ein dominierendes Thema in Teilen der westlichen Welt. Wieso?
Warum Klimaschutz dominant wurde
Die moderne politische Ökonomik empfiehlt, das Bewirtschaftungspotenzial des Themas Klimaschutz zu analysieren. Dabei zeigt sich Erstaunliches: Weil dauerhafter und globaler Klimaschutz zwar sinnvoll, aber kaum durchsetzbar ist, bot er mehrere ideale Voraussetzungen für eine gezielte politische Bewirtschaftung.
Moralische Inszenierung. Die Forderung nach mehr Klimaschutz diente als billige Möglichkeit, sich zu inszenieren. Politiker und Aktivisten konnten für das „Richtige“ Haltung zeigen, ohne Verantwortung zu übernehmen. Zielkonflikte blieben ausgeblendet. Dass geforderte individuelle oder nationale Beiträge zur Emissionsreduktion weltweit kaum ins Gewicht fallen würden, störte nicht – im Gegenteil: Gerade die faktische Wirkungslosigkeit der eigenen Klimaschutzansätze machte das moralische Schaulaufen zum politischen Kapital. Junge Klimaaktivisten wie Greta Thunberg perfektionierten die Inszenierung, ohne jene Zielkonflikte anzusprechen, die eine Umsetzung ihrer Forderungen zwangsläufig mit sich gebracht hätte.
Neue Geschäftsmodelle. Manche Unternehmen erkannten das Bewirtschaftungspotenzial des Themas Klimaschutz. Sie präsentierten ihre Produkte als Beitrag zur Rettung der Erde und sicherten sich dafür teils staatliche Subventionen. Erneuerbare Energien, E-Mobilität oder grüne Finanzprodukte: Die Kombination aus Geschäftsinteresse und moralischer Aufladung erwies sich für einige als lukratives Geschäftsmodell und eignete sich auch für Marketingzwecke.
Verwaltungslust auf Regulierung. In staatlichen Verwaltungen stieß das Thema Klimaschutz kaum auf Widerstand – im Gegenteil: Neue Zuständigkeiten, zusätzliche Ressourcen und erweiterte Kompetenzen machten die Klimaschutz-Verwaltung attraktiv. Gleichzeitig boten Klimaregulierungen und neue Abgaben den politischen Entscheidungsträgern erweiterte Handlungsspielräume und zusätzliche Einnahmequellen, um ihre Klientel zu bedienen.
Sündenbockfunktion. Der Klimawandel bot eine bequeme Erklärung für vielfältige Missstände. In Entwicklungsländern wurde Armut zunehmend auf klimatische Veränderungen zurückgeführt, während Probleme wie Korruption und schlechte Regierungsführung in den Hintergrund traten. In westlichen Staaten diente der Klimawandel oft als Entlastungserzählung: Versäumnisse beim Hochwasserschutz oder mangelhafte Vorbereitung auf Extremwetter wurden von den Verantwortlichen der Erderwärmung angelastet.
Zumindest für eine gewisse Zeit eignete sich Klimaschutz hervorragend zur Bewirtschaftung gewisser wirtschaftlicher und insbesondere politischer Interessen.
Warum das Meinungsklima gegen Klimaschutz kippen dürfte
Vieles spricht jedoch inzwischen dafür, dass der Klimaschutz als politisches Megathema an Bedeutung verlieren wird. Die grundlegende ökonomische Einsicht, dass wirksamer Klimaschutz dauerhaft glaubwürdiges, weltweites Handeln erfordern würde – und deshalb strukturell zum Scheitern neigt –, setzt sich zunehmend durch. Mehrere Entwicklungen deuten auf ein absehbares Ende der politischen Bewirtschaftung hin.
Rückkehr der Nüchternheit. In der öffentlichen Debatte wird die offensichtliche Wirkungslosigkeit nationaler Maßnahmen gegen ein weltweites Phänomen häufiger thematisiert. Je deutlicher sich zeigt, wie gering der Einfluss einzelner Staaten oder gar Individuen ist, desto schwerer fällt es, den Aufwand für Klimaschutz rhetorisch und insbesondere finanziell zu rechtfertigen.
Themenkonkurrenz: Neue Themen rücken in den Vordergrund. Gesundheit, militärische Verteidigung und Wirtschaftswachstum konkurrieren zunehmend direkt mit dem Klimaschutz – nicht nur um öffentliche Aufmerksamkeit, sondern vor allem um finanzielle Mittel. Ein Euro kann nur einmal ausgegeben werden. Daher stellt sich die Frage, welchen gesellschaftlichen Nutzen ein Euro für Klimaschutz im Vergleich zu einem Euro für Verteidigung oder andere zentrale Aufgaben stiftet. Zudem ist klar, dass viele Regulierungen im Klimabereich das Wachstum eher hemmen.
Relativierung: Mit der Themenkonkurrenz wächst das Bedürfnis nach Verhältnismäßigkeit. Prognostizierte weltweite Klimaschäden in Billionenhöhe wirken weit weniger dramatisch, wenn sie ins Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt gesetzt werden. Berücksichtigt man zusätzlich das Wirtschaftswachstum, entspräche selbst ein dauerhafter, jährlicher Nettoschaden von fünf Prozent der Wirtschaftsleistung im Jahr 2100 lediglich einer Senkung der jährlichen Wachstumsrate bis dahin um etwa 0,06 Prozentpunkte – ein wohl eher schwach spürbarer Effekt.
Perspektivenwechsel. Mit dem Verfehlen zentraler Klimaziele und dem Ausbleiben der „Klimaapokalypse“ vollzieht sich ein Perspektivenwechsel. Die Einsicht wächst, dass es sich auch mit ein, zwei oder drei Grad Erwärmung durchaus gut leben lässt, sofern Anpassungsmaßnahmen erfolgreich sind. Die Kosten, um das 1,5-Grad-Ziel vielleicht zu erreichen, wären hingegen selbst für wohlhabende Länder im Grunde nie tragbar gewesen. Schätzungen zufolge hätten die Kosten pro Österreicher rund 25.000 Euro jährlich betragen. Insofern war das 1,5-Grad-Ziel immer ökonomisch unsinnig. Derartige Ziele – ähnlich wie die Klimanotstände – unterminieren nun die Glaubwürdigkeit anderer Klimaschutzmaßnahmen
Anpassung statt Prävention: Der Fokus verschiebt sich vom moralisch aufgeladenen Klimaschutz hin zur pragmatischen Anpassung. Diese lässt sich ohne große Inszenierung privat oder lokal organisieren, hat überschaubare Kosten und entfaltet unmittelbare Wirkung – etwa durch Investitionen in Infrastruktur, Kühltechnik oder städtische Planung.
Was folgt nun? Lange reichte es, im Klimaschutz das „Richtige“ zu wollen. Ähnlich wie fast alle den Weltfrieden wollen, wird auch das Thema Klimaschutz von der Realität eingeholt. Es dürfte zu einem Randthema werden, das hin und wieder Aufmerksamkeit erregt. Zu hoffen wäre nur, dass nicht bald ein anderes Thema so exzessiv politisch bewirtschaftet wird wie der Klimaschutz. Ein nüchterner, ökonomischer Pragmatismus wäre wünschenswert.




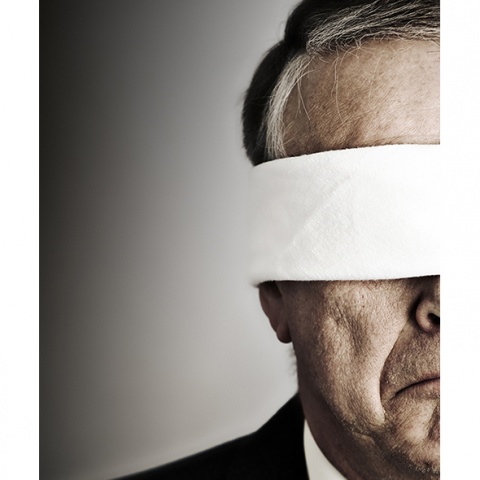









Kommentare