
Deutsche Staatsverschuldung à la française
Je nach Perspektive steht Deutschland nicht schlecht da: Die kaufkraftbereinigte Wirtschaftsleistung pro Kopf liegt etwa zehn Prozent über der von Frankreich oder Großbritannien. Nach vergleichbaren Zahlen der OECD ist der deutsche Staatsschuldenstand mit rund 63 Prozent deutlich unter dem von Frankreich oder Italien, die beide mit über 100 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung verschuldet sind – Italien sogar mit fast 150 Prozent. Österreich liegt bei rund 82 Prozent. Auch ist die deutsche Infrastruktur nicht in schlechterem Zustand als die von Frankreich, Italien oder Großbritannien. Doch wird Deutschland hier jeweils mit Ländern verglichen, die selbst kaum als vorbildlich gelten. Zudem fehlt es in Deutschland an wirtschaftlicher Dynamik.
Deutschlands strukturelle Probleme
Die Ursachen für die Krise Deutschlands sind bekannt. Es handelt sich weniger um ein konjunkturelles Tief, vielmehr leidet das Land an strukturellen Problemen.
Die Energiepreise in Deutschland zählen zu den höchsten der industrialisierten Welt. Das liegt vor allem an einer Energiepolitik, die auf wetterabhängigen Strom setzt. Dieser ist teuer, wenn das Wetter nicht mitspielt, verschlingt massive Subventionen und braucht entweder riesige Speicheranlagen oder ein fossiles Backup, was ihn derzeit relativ dreckig macht.
Hinzu kommt ein Wust an Bürokratie, die Unternehmen lähmt, Bürger teilweise schikaniert und Investitionen sowie Innovationen hemmt.
Das deutsche Sozialsystem mit hohen Steuern und Abgaben setzt negative Anreize: Wer arbeitet, verdient oft nicht deutlich mehr als jemand, der nicht arbeitet. Länger und mehr zu arbeiten, lohnt sich für viele aufgrund der Belastungen durch Steuern kaum. Steuerliche Anreize für ältere Bürger, über das reguläre Renteneintrittsalter hinaus zu arbeiten, fehlen. Und all das, obwohl nach Fachkräften gesucht wird.
Schulden lösen keine Strukturprobleme
Mitte März schaffte der Deutsche Bundestag durch ein sogenanntes Sondervermögen sowie eine Lockerung der verfassungsrechtlich verankerten Schuldenbremse neue Verschuldungsmöglichkeiten. Künftig fallen Verteidigung- und sicherheitspolitische Ausgaben, die ein Prozent der Wirtschaftsleistung übersteigen, nicht mehr unter die Schuldenbremse. Zudem wurde ein schuldenfinanzierter, wirtschaftlich verselbständigter Nebenhaushalt (Sondervermögen) in Höhe von 500 Milliarden Euro beschlossen, woraus über zwölf Jahre zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur fließen sollen. 100 Milliarden Euro sind für Maßnahmen mit dem Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 vorgesehen. Abhängig von der Entwicklung der Verteidigungsausgaben könnte das Volumen der neuen Schulden rund eine Billion Euro überschreiten. Die deutsche Staatsverschuldung könnte auf über 90 Prozent der Wirtschaftsleistung steigen.
Geld allein löst noch keine Strukturprobleme. So ist unklar, wie sichergestellt wird, dass der zusätzliche Nutzen der Schulden die Kosten übersteigt. Unklar ist auch, wie überhöhte Preise – etwa beim Kauf von Verteidigungsmaterial oder bei Infrastrukturprojekten – vermieden und wie Beschaffungskorruption unterbunden werden kann. Viel Geld, das schnell ausgegeben werden soll, zieht Missbrauch an. Die übliche politische Selbstbedienungsmentalität wird durch das viele Geld eher befeuert als eingedämmt.
Selbst wenn staatliche Investitionen wohlfahrtsförderlich sein könnten, ist die praktische Umsetzung oft mangelhaft: Genehmigungsverfahren ziehen sich über viele Jahre, die Baukosten öffentlicher Projekte tendieren zur Explosion, und die staatliche Planung ist weniger an der Wohlfahrt der Bürger orientiert als von ideologischen Erwägungen geleitet. Realistischerweise dürfte ein großer Teil der neuen Schulden nicht direkt in Infrastruktur fließen, sondern in Förderprogramme mit unsicheren Wachstums- und Wohlfahrtseffekten.
An den echten Problemen vorbei
Grundsätzlich gilt: Wird Geld primär für die Transformation der Wirtschaft ausgegeben, ist der Effekt auf wirtschaftliches Wachstum weitgehend inexistent. Wachstum bedeutet, dass mehr Güter oder Güter von besserer Qualität erzeugt werden. Wenn also beispielsweise Förderungen von „grünem“ Stahl die bestehende Stahlproduktion nur ersetzen, ergibt sich kein positiver Wachstumseffekt.
Auch ist der Nutzen der 100 Milliarden Euro für das Ziel der Klimaneutralität fragwürdig. Ausgaben zur CO2-Reduktion haben im Rahmen des bestehenden EU-Emissionshandels (EU-ETS) keinen direkten Effekt auf die europaweiten CO2-Emissionen. Der EU-ETS legt eine Obergrenze für Emissionen in den von ihm erfassten Bereichen fest. Jeder zusätzlich in Deutschland ausgegebene Euro verändert aber die Gesamtmenge an CO2-Emissionen im EU-Raum jedoch nicht. Hinzu kommt, dass Klimaschutz ein globales öffentliches Gut ist – Deutschland allein kann kaum etwas bewirken. Wer etwas anderes behauptet, ist „klimanaiv“ und schädigt die Wohlfahrt insbesondere jüngerer Bürger, die die Schulden tragen müssen. Hier täte die österreichische Politik gut daran, mit Skepsis auf die deutschen Nachbarn zu schauen und „Weltretter-Ambitionen“ auf vielversprechendere Politikbereiche zu fokussieren.
Verschuldet sich Deutschland deutlich höher, sind selbstverständlich höhere Zinszahlungen fällig. Bereits die Ankündigung des Schuldenpakets ließ die Renditen auf deutsche Staatsanleihen und die Anleihen anderer EU-Staaten um rund 40 Basispunkte steigen, was Kredite für alle teurer macht.
Der Weg, den die deutschen politischen Entscheidungsträger einschlagen, gleicht einer wirtschaftlichen Französisierung Deutschlands: weiterhin schwächelndes Wirtschaftswachstum bei schnell steigender Verschuldung, hoher Staatsquote und hoher Regulierungsdichte. Mit Blick auf Österreich dürften die neuen deutschen Schulden der hiesigen Wirtschaft bestenfalls ein kurzes Strohfeuer bescheren und mittelfristig weniger nutzen als ein fiskalisch diszipliniertes Deutschland. Österreich profitiert von wirtschaftlich starken und soliden Nachbarn. Nicht zuletzt dürfte auch die hiesige fiskalpolitische Disziplin leiden, wenn der große Nachbar nicht einmal mehr in diesem Bereich als Vorbild taugt.
Was helfen würde
Im Grunde wären die Malaise Deutschlands erstaunlich einfach zu kurieren. Es sind politische Fehlsteuerungen, die das Land lähmen – allen voran eine überbordende Bürokratie und mangelnde Leistungsanreize aufgrund des Steuersystems.
Ein echter Bürokratieabbau ließe sich durch ein Verbot von Doppelregulierungen erzielen. Als Prinzip muss gelten, dass ein politisches Ziel nur mit einer regulatorischen Maßnahme adressiert werden darf. Ein Beispiel: Der EU-Emissionshandel (EU-ETS) reguliert bereits europaweit den CO2-Ausstoß und führt zu einem CO2-Preis, der Anreize setzt, CO2 effizient zu reduzieren. Die Erweiterung des EU-ETS im Jahr 2027 auf unter anderem die Bereiche Verkehr und Gebäude macht zusätzliche Regulierungen im Klimabereich im Grunde überflüssig. Eingriffe wie das deutsche „Heizungsgesetz“ (offiziell Gebäudeenergiegesetz) sind dementsprechend Doppelregulierungen. Sie sind ineffizient, schaden der Wirtschaft und reduzieren die Wohlfahrt der Bürger. Das Bürokratieabbaupotenzial durch die Abschaffung von Doppelregulierungen ist in Deutschland – ähnlich wie in Österreich und vielen EU-Ländern – enorm. In Deutschland ist Regulierungsabbau sogar noch wichtiger als anderswo in der EU, denn deutsche Unternehmen und Bürger haben im Vergleich zu manch anderen Europäern die Tendenz, die bestehenden Doppelregulierungen ernst zu nehmen, statt sie zu ignorieren oder zu umgehen.
Der zweite große Hebel betrifft Leistungsanreize. Hier könnten zwei Maßnahmen große Wirkung entfalten: Erstens eine Halbierung des Einkommensteuersatzes für Beschäftigte, die nicht mit dem Renteneintrittsalter ihre Arbeit niederlegen, sondern freiwillig weiterarbeiten. Die Überalterung der deutschen Bevölkerung ist kein Problem – sie ist ein Glück. Die Deutschen werden nicht alt, weil sie krank und schwach sind. Sie werden alt, weil sie oft gesund und vital sind. Diese Früchte des Glücks der Überalterung müssen nur geerntet werden. Die „Alten“ sind in der Regel hochqualifizierte und wertvolle Fachkräfte. Doch lohnt es sich für sie aufgrund hoher Steuern meist nicht, deutlich länger zu arbeiten. Durch eine Halbierung des Einkommensteuersatzes für jene, die weiterarbeiten, statt in Rente zu gehen, gewinnen alle. Die Unternehmen behalten fähige Fachkräfte, die „Alten“ profitieren von einem höheren Nettolohn, das Rentensystem wird entlastet und der Staat erhält weiter Steuereinnahmen auf den Erwerbseinkommen. Neben dieser Reform im Rentenbereich sollten auch weitere Arbeitsanreize geschaffen werden, indem Überstunden steuerlich begünstigt werden. Wer freiwillig mehr als 40 Stunden pro Woche arbeitet, sollte durch einen Steuerfreibetrag von 20 Euro je geleisteter Überstunde entlastet werden. So würde signalisiert: Arbeit lohnt sich!
Eine Reduktion von Bürokratie und bessere Anreize durch wohlfahrtssteigernde Änderungen im Steuersystem könnten Deutschland schnell wieder fit machen – ganz ohne Milliardenschulden. Derartige Reformen könnten sogar zu mehr Dynamik in der Europäischen Union führen. Auch die Europäische Union leidet unter tiefen Wirtschaftswachstumsraten, zu hoher Verschuldung vieler ihrer Mitglieder, Problemen am Arbeitsmarkt und unter überbordender Bürokratie. Insofern wäre es ein Malheur für alle, wenn Deutschland wirtschaftlich französisiert würde.




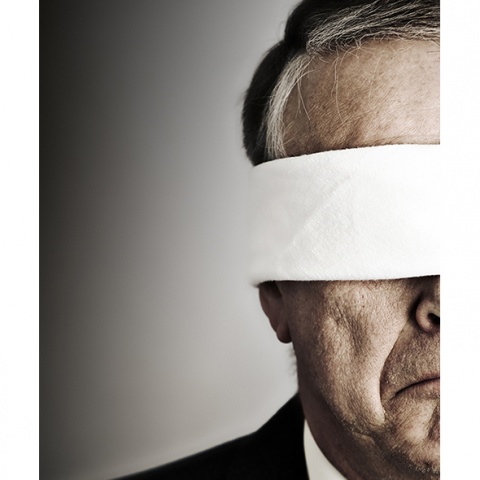








Kommentare