
Handel ohne Händel – außer vielleicht mit China
Die Zollpolitik der US-Regierung hat zumindest einen positiven Nebeneffekt: In Europa wandeln sich manche Gegner des Freihandels plötzlich zu Befürwortern und kritisieren fast einhellig die hohen US-Importzölle als schädlich für Europa und die USA. Dabei war immer schon klar, dass Freihandel in aller Regel wohlfahrtsfördernd ist und ein hervorragendes Grundprinzip darstellt.
Freihandel fördert die Wohlfahrt
Warum schafft Freihandel Wohlstand? Mehrere ökonomische Mechanismen spielen eine Rolle:
Spezialisierung: Länder spezialisieren sich im freien Handel auf Güter, deren Produktion sie vergleichsweise effizient beherrschen. Dies erhöht die Gesamtproduktion und steigert durch den Austausch die Wohlfahrt aller.
Skaleneffekte: Dank größerer Absatzmärkte können die Durchschnittskosten der Produktion sinken, insbesondere für Unternehmen mit relevanten Fixkosten oder Branchen mit hohen Anfangsinvestitionen.
Vielfalt: Konsumenten profitieren von einem vielfältigeren Warenangebot bei zugleich günstigeren Preisen.
Technologietransfer: Freihandel erleichtert den Austausch und die Nutzung von Technologien. Unternehmen profitieren von Innovationen anderer Länder, was wiederum die Innovationsfähigkeit im eigenen Land fördert.
Durch Freihandel sinken die Preise für Konsumgüter, während gleichzeitig produktivere Wirtschaftsstrukturen entstehen und technologischer Fortschritt vor-anschreitet. Dadurch steigen die Reallöhne und der Wohlstand. Diese Effekte gelten nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb von Ländern. Niemand würde ernsthaft Handelsbarrieren zwischen Tirol und Vorarlberg oder zwischen Texas und Louisiana fordern. Handelsbarrieren innerhalb eines Landes gelten sogar unter Gegnern von Freihandel als absurd.
Der Nobelpreisträger Milton Friedman verdeutlichte allgemein das Potenzial freier Märkte eindrucksvoll am Beispiel eines Bleistifts. Niemand kann sinnvollerweise alles selbst herstellen – nicht einmal etwas scheinbar Einfaches wie einen Bleistift. Holz, Graphit und Lack werden in verschiedenen Ländern produziert. Zur Holzgewinnung sind Sägen aus Stahl nötig, dessen Herstellung selbst viele Schritte erfordert. Tausende Menschen verschiedener Nationalitäten, Hautfarben, Religionen, etc. kooperieren rund um den Globus, ohne staatliche Planung, verbunden allein durch Preismechanismen des freien Marktes. So entstehen Bleistifte zu sehr günstigen Preisen – ein wahrer Wohlfahrtsgewinn.
Natürlich gibt es auch Einwände gegen völlig uneingeschränkten Handel. Kurzfristig entstehen Verlierer während der Handelsöffnung, etwa in Branchen, die mit günstigen Importen nicht konkurrieren können. Hier nützen flankierende Maßnahmen im Sinne der sozialen Marktwirtschaft: Bildungs- und Umschulungsangebote sowie eine gewisse soziale Absicherung, idealerweise finanziert durch die hohen Gesamtgewinne des Freihandels.
Verpasste Chancen
Angesichts der Wohlfahrtsgewinne von Freihandel und nun drohender Handelskonflikte ist es bedauerlich, dass TTIP – die einst geplante transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft zwischen den USA und der EU – nicht umgesetzt wurde. Seit Donald Trumps erster Wahl liegt das Abkommen auf Eis.
Doch schon zuvor wurde TTIP in Europa bekämpft, auch von Umweltorganisationen und politischen Akteuren, die heute ironischerweise die amerikanischen Zölle kritisieren. TTIP hätte gemäß manchen Schätzungen Europa bis zu vier Prozent und den USA sogar knapp fünf Prozent Wohlfahrtsgewinne gebracht. Gegen Freihandel zu sein, ist meist schädliche Politik!
Strategische Handelspolitik?
Wenn Freihandel so vorteilhaft ist, warum setzen die USA nun auf Zölle? Manche behaupten, die amerikanische Regierung habe den (ökonomischen) Verstand verloren. Doch andere für „dumm“ zu halten, ist selten klug. Wahrscheinlicher ist, dass ein anderes Kalkül dahintersteht: strategische Handelspolitik gegen das autoritäre System in China.
Allgemein kann durch strategische Handelspolitik – etwa mit Zöllen, aber ebenso mit Subventionen – versucht werden, heimische Industrien aufzubauen, insbesondere dort, wo Größenvorteile eine Rolle spielen. Strategische Handelspolitik wird auch mit dem Hinweis auf negative externe Effekte wie Umweltverschmutzung gerechtfertigt. So plant die EU neue Zölle auf Importe aus Ländern ohne strenge Klimastandards (also mitunter die USA). Bereits seit Herbst 2023 läuft die Übergangsphase des europäischen CO2-Grenzausgleichssystems, wo es vor allem um die Erfassung der Emissionen von Importgütern geht. „Klimazölle“ wären ab 2026 vorgesehen. Weiters kann ein großes Land wie die USA gemäß Theorie sogenannte „optimale Zölle“ erheben. Aufgrund einer gewissen Marktmacht können die USA mit Zöllen die Importpreise vor dem Zollaufschlag drücken und dadurch einen Nettogewinn erzielen. Und natürlich kann mit strategischer Handelspolitik versucht werden, strategische Konkurrenten in Zaum zu halten – im Falle der USA ist das nicht die EU, sondern China.
Die Schwächen strategischer Handelspolitik sind jedoch offensichtlich: Staatliche Subventionen sind kostspielig und führen keineswegs zuverlässig zum Aufbau wettbewerbsfähiger Industrien. Maßnahmen wie Klimazölle sind mit erheblichem bürokratischem Aufwand verbunden, dürften nahezu keinen Klimaschutzeffekt bringen und bieten viel Missbrauchspotenzial – etwa als Deckmantel für klassischen Protektionismus. Ob strategische Gegner wie China durch Zölle sinnvoll eingeschränkt werden, ist zweifelhaft. Zudem sind Handelskonflikte bei Anwendung strategischer Handelspolitik vorprogrammiert, wie die USA derzeit zeigen.
All dies spricht dafür, dass Freihandel das überlegene Grundprinzip bleibt. Auch wenn er nicht immer und in jedem Einzelfall uneingeschränkt vorteilhaft ist, erweist sich Freihandel als die klügere Strategie im Vergleich zu strategischer Handelspolitik.
Eine Lektion könnten wir Europäer nun lernen: Wir sollten sofort vollständigen Freihandel mit den USA anstreben, gegebenenfalls einseitig unsere Handelsbarrieren senken und einen pragmatischen, aber mit den USA gut koordinierten Umgang gegenüber dem autoritär regierten China entwickeln.




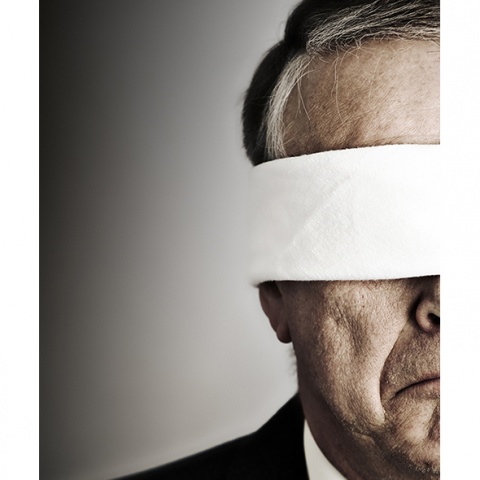








Kommentare