
Eine Feldkirch-Odyssee
Von Oliver Ruhm (45) – er ist schon sein halbes Leben lang Unternehmer in der Vorarlberger Kreativbranche.
Als ich mit 28 ankündigte, eine Haushälfte in Nofels kaufen zu wollen, drohte mein Vater mir mit der Enterbung. Klingt jetzt erst mal dramatisch. Mit prüfendem Blick auf die Familienreichtümer erschien mir das Risiko jedoch überschaubar und ich wagte den Schritt über die Ill, um mich in 2700 Metern Luftlinie von meinem Gisinger Elternhaus niederzulassen. Die Einheimischen waren reserviert, aber größtenteils tolerant. Die diplomatischen Wogen gegenüber der „Alten Welt“ glätteten sich schließlich.
Einige Jahre später wurde der Wohnraum für unsere zwischenzeitlich gegründete Familie knapp und wir machten uns erneut auf die Suche nach einer neuen Bleibe. Fündig wurden wir nach zahlreichen Versuchen schließlich in der alten Heimat jenseits der Ill, die sich auf dem Rückweg übrigens partout nicht teilen wollte. Den örtlichen Bräuchen entsprechend legten wir ein „Kaufanbot“ für ein hundertjähriges Haus im Gisinger Ortskern und harrten Tag für Tag auf die Rückmeldung der Verkäufer. Die Erlösung erreichte uns auf unerwarteten Schwingen: Beim Einkauf in der dörflichen Bäckerei informierte uns die Dame des Hauses, dass wir den Zuschlag bereits erhalten hätten. Das wüssten alle schon. Einige Tage später bestätigte uns der Makler diese mehlgestäubte Verheißung.
Der Abstand zum elterlichen Schornstein schrumpfte also auf 300 Meter. Ich erinnere mich an einen ersten Spaziergang durch das Dorf: Ich fühlte mich, wie sich historische Heimkehrer so fühlen mochten, die nach Jahren in der Ferne die Heimat mit neuen Augen betrachteten. Ich war in bester Gesellschaft mit Odysseus, Kolumbus und Napoleon, könnte man sagen. Endlich wieder zuhause.
Im Zuge der folgenden Sanierungsarbeiten begrüßten mich eines Morgens Passanten mit einem freundlichen „Good morning!“, welches ich verwundert erwiderte. Als ich bei folgender Gelegenheit erneut auf Englisch angesprochen wurde und im Dialekt antwortete, klärte sich die Lage. Im Dorf wurde erzählt, unsere Familie sei aus Schweden zugezogen. Ich erkundigte mich nach dem Grund und erfuhr, dass diese Schlussfolgerung auf drei Fakten basierte. Erstens: Unser Volvo-Kombi. Zweitens: Wir hatten die Fensterläden des Hauses himmelblau gestrichen. Drittens: Unser skandinavischer Einrichtungsstil ohne abschirmende Vorhänge oder Gardinen. „Gut zu wissen“, sagte ich. Eine Weile grüßte ich mit einem beherzten „Hej!“
Ein zweites Gerücht ist jüngerer Natur. Ich erfuhr von einem Jugendfreund (230 Meter Luftlinie), dass er von seiner Schwester vor unserem Haus gewarnt worden war. Nach ihrer Information lebten dort nämlich Anhänger einer missionarischen Glaubensgemeinschaft. Erstens würde man uns nie in der Gisinger Kirche antreffen. Der zweite Grund fußte auf noch handfesteren Beweisen: das Schild an unserer Fassade.
Antiquarisch erstand ich ein Jahr zuvor ein Leuchtschild, das zufällig den Namen meines damaligen Unternehmens verkündete. Es stammte aus einer alten Zürcher Apotheke. Aus Freude am Fund hängte ich es (unbeleuchtet) an meine Fassade. Eine Silbe teilt sich der Firmenname mit einer bekannten Religionsgemeinschaft. Beweisführung abgeschlossen, euer Ehren.
Welche anderen Gerüchte und Geschichten über unsere Familie kursieren, weiß ich nicht. Dass ich in manchen Dingen anders fühle, denke und handle, ist für mich weder neu noch überraschend. Damit verdiene ich als Berufskreativer seit 20 Jahren mein Geld. Und doch ertappe ich mich immer wieder in meinem Wunsch, mich besser einzufügen und ein bisschen mehr so zu sein, wie die Menschen um mich. Nadine lacht, wenn ich wieder einmal ein Poloshirt kaufe oder meine Chinos vor einer wichtigen Präsentation bügle. Sie kennt mich: lange halte ich es nicht durch, mich zu verbiegen. Sie war es, die mir dabei geholfen hat, zu erkennen: Wir können auch dazugehören, wenn wir nicht ganz gleich sind wie alle anderen. Sogar als schwedische Missionare in Gisingen.








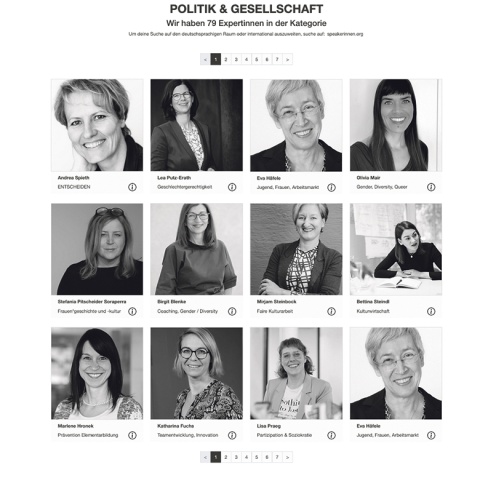

Kommentare