Der Wettlauf zwischen Mensch und Roboter
In den kommenden zwei Jahrzehnten würden 47 Prozent der Jobs, in denen heute noch Menschen eingesetzt werden, durch Automaten ersetzt werden. Dieser Forschungsbericht von C. B. Frey und M. Osborne (Oxford 2013) wird mittlerweile oft zitiert. Regelmäßig taucht er auf den Management-Seiten der Medien, in den Empfehlungen von Consultants und in politischen Erklärungen auf. Er soll auf den enormen technischen Fortschritt hinweisen, der im Gang ist und sich noch beschleunigen wird. Das werde enorme Umwälzungen mit sich bringen, etwa im Bildungssystem, in der Unternehmensführung, im Sozialsystem und in der Verteilung der materiellen Wohlstands.
Automatisiert würden alle Beschäftigungen werden, die ständig wiederholte (repetitive) Arbeitsgänge beinhalten oder nach feststehenden und geregelten Routinen durchzuführen sind. Dies werde nun, nach der Epoche, in der in erster Linie menschliche Arbeitskraft im eigentlichen Sinn (Kraft) durch Maschinen ersetzt wurde, auch weit eingreifen in viele Dienstleistungsberufe. Die nächste Stufe der Industrialisierung werde den Ersatz von menschlicher Denkfähigkeit bringen. (Es fällt schwer, hier nicht zu bemerken, dass diese gar nicht selten auch ohne Ersatz verloren geht.)
Stark vergröbert und sogar irreführend werden die Aussagen der an sich seriösen Studie oft so interpretiert, dass um das Jahr 2030 fast die Hälfte der jetzt Beschäftigten arbeitslos sein werden.
Das Thema eines Wettlaufs zwischen Mensch und Maschine ist überhaupt nicht neu in Praxis und Theorie der Wirtschaft. Es tauchte schon in den frühesten Phasen der Industrialisierung auf, als Maschinenstürmer gegen die Verwendung von Dampfmaschinen kämpften, und Weber gegen moderne Webstühle – und dabei deren Erfinder Joseph Maria Jacquard halbtot schlugen. Nun sei die Wirtschaft in eine Ära eingetreten, in der sich die Anwendung digitaler Elemente nicht auf das Ersetzen von Routinen beschränke. Die zunehmende „Intelligenz“ – sagen wir vorsichtiger: Rechenleistung – werde nun auch Arbeitsschritte ersetzen, die bis jetzt vom menschlichen Gehirn rascher vollzogen und gesteuert werden können. Komplizierte Aufgaben werden in viele kleine kybernetische Vorgänge zerlegt, die von leistungsstarken Computern rascher und weniger fehleranfällig durchgeführt werden können als durch menschliche Arbeit. Dabei kann das System auf viel mehr gespeicherte Informationen zurückgreifen, als ein Mensch parat haben kann. Das ist ja längst im Gang. Der Fahrkartenautomat hat schon ziemlich viele Schalterbeamte ersetzt. Und präzise Auskünfte bekommt man auch eher, richtiger und vollständiger aus dem Internet als von leibhaftigen Experten.
Aber das bedeutet noch lange nicht, dass damit im gleichen Ausmaß, wie Arbeit ersetzt wird, Arbeitslosigkeit entsteht. Das würde ja heißen, dass keine neuen Bedürfnisse und Aufgaben entstehen können als die, die bisher schon Produkte und Dienstleistungen nachfragen. Die neuen Stufen der Technologie bedeuten erstens erhöhte Produktivität, und diese automatisch eine Steigerung von Einkommen und entsprechender Nachfrage. Diese schafft wiederum Arbeit, wenn auch mit sinkendem Anteil menschlicher Inputs. Und zweitens: Mit neuen Technologien werden neue, bisher latente Bedürfnisse geweckt, die bisher gar nicht erkennbar waren, weil die Voraussetzungen für ihre Verwendung (Kosten, Zeitaufwand, Risiken …) fehlten.
In diese Richtung geht nun ein im Juli veröffentlichter Bericht des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim und der Universität Utrecht (Autoren: T. Gregory, A. Salomon, U. Zierahn). Es ist freilich ungleich schwieriger zu schätzen, welchen Umfang künftige, heute noch nicht erkannte Nachfrage nach neuartigen Produkten und Dienstleistungen haben könnte. Das grenzt an Science-Fiction, aber dennoch ist die Frage richtig. Natürlich senkt das nicht das Ausmaß der freigesetzten Arbeit. Aber Arbeitslosigkeit entsteht nicht im gleichen Ausmaß, weil ja neue Bedürfnisse und Berufe auftreten und Arbeit erfordern. Das Ergebnis hängt stark von Annahmen ab, etwa wann und in welcher Richtung die Einkommensverteilung und die regionale Umgebung darauf reagieren. Die Studie ist auch nicht so optimistisch, dass netto mehr Arbeitsplätze entstehen könnten, als durch neue Technologien verloren gehen. Zwischen der Freisetzung „alter“ Arbeitsvorgänge und der wirksamen Nachfrage nach „neuen“ können sehr wohl Übergangskrisen auftreten. Aber annähernd die Hälfte des Verlusts würde durch innovative neue Beschäftigung und Produktion ausgeglichen. Immerhin.
Nun noch ein weiterer Schritt: Laut dieser Studie sei absehbar, dass der exponentielle Anstieg der Computerleistung zu einer „Intelligenzexplosion“ der künstlichen Intelligenz führen werde, sodass sie den menschlichen Fähigkeiten, dies zu kontrollieren, davonlaufen könnte (Zustand der „technologischen Singularität“). Umstritten sei dabei nur, ob die künstliche Intelligenz den Menschen gegenüber freundlich oder feindlich sein könnte. Aber ein bisschen Hilfe von einer Superintelligenz könnte die heutige Menschheit gar nicht schlecht brauchen. Das stößt in den Bereich atemberaubender Fiktionen vor, zu denen man sich heute noch keine feste Meinung bilden kann. Erstaunlich ist aber schon, dass die Extrapolation der bisher beobachteten exponentiellen Entwicklung künstlicher Intelligenz ergebe, dass die Menschheit in ein solches Zeitalter schon in eineinhalb bis zwei Jahrzehnten eintreten werde. Der Unterschied zwischen Mensch und Maschine werde dann aufgehoben sein. Während Fanatiker erwarten, „dass wir auch Sex mit Robotern haben werden“ (M. Walker, A.-T. Kearney), brauchen das gesetztere Naturen wie der Autor wirklich nicht.
Schon heute drängt uns die Computerindustrie ständig neue Produkte auf, nach denen kaum jemand gefragt hat. Aber das hindert viele nicht, über Nacht Schlange zu stehen, wenn eine neue Version eines Smartphones angekündigt ist.
Der Autor hält es mit dem weisen Satz des genialen Pablo Picasso: „Eigentlich sind Computer nutzlos. Sie können nur Antworten geben.“ Wichtiger als blitzschnelle Antworten sind gescheite Fragen. Die können nur Menschen stellen.

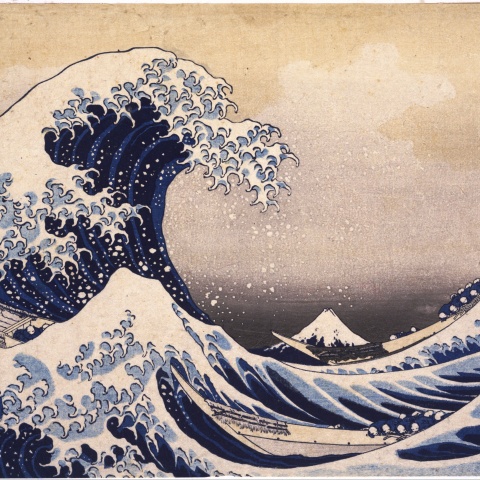










Kommentare