
Wirtschaftswachstum
Überwindung der Stagnation oder Treibstoff der Umweltkatastrophe?
Auseinandersetzungen über das Wirtschaftswachstum sind nicht neu: Die Ökonomen mussten lernen, dass dem Verbrauch von natürlichen Rohstoffen prinzipiell Grenzen gesetzt sind. Die Ökologen hingegen mussten zur Kenntnis nehmen, dass die mechanische Extrapolation von Trends in die Zukunft nahezu immer Katastrophen ankündigt. Aber ihr Eintreten bleibt dann aus. Wir leben nicht inmitten gestorbener Wälder, wie wir vor drei Jahrzehnten befürchten mussten. Ein Versiegen der Öl- und Gasreserven ist nicht absehbar, obwohl es vor 40 Jahren enorme Aufregung um die „Grenzen des Wachstums“ verursachte. Seither hat der Verbrauch fossiler Brennstoffe enorm zugenommen. Zwar ist die Angst vor einem harten Aufprall des wachsenden Materie- und Energieverbrauchs an der Endlichkeit des Raumschiffs Erde nicht unbegründet. Sie hat mit der Jahrtausende alten menschlichen Suggestion von „Mutter Erde“ zu tun und entspricht auch den Lebenserfahrungen jedes Einzelnen. Aber für die ganze Menschheit liegt der Fall komplizierter.
Die Erdbevölkerung wird nicht zunehmen, bis die nötige Nahrung physisch nicht mehr gewonnen werden kann. Irgendwann nach 2050 wird die Zunahme der Erdbevölkerung ihren Scheitelpunkt erreichen, an dem sich Geburten und Todesfälle die Waage halten. Leider gab es immer und gibt es auch heute Regionen der Erde, in welchen Menschen verhungern. Diese schreckliche Tatsache hat wenig damit zu tun, dass die Erde scheinbar heute schon nicht alle Menschen ernähren kann. Physisch ist diese Situation noch lange nicht erreicht.
Schuld ist viel eher das Unvermögen menschlicher Organisation, die Beharrung auf bisherigen Gewohnheiten und der Mangel an Mitmenschlichkeit. Prognosen einer Götterdämmerung übersehen meist, dass Ersatz für zu knapp werdende natürliche Rohstoffe gefunden werden kann: sie werden durch Alternativen ersetzt, ihr Verbrauch wird sparsamer, sie werden wieder in den Güterkreislauf zurückgeführt (recycliert). Sie werden auch unmodern, unpraktisch oder unattraktiv. Moden wechseln, nach ausreichend vielen Stau-Erlebnissen im eigenen Auto sucht man andere Formen der Mobilität. Vor allem aber wirkt der Preismechanismus: Knappe Güter werden teurer und lösen die Suche nach anderen Rohstoffen oder neuen Technologien aus.
Sollen wir die Klimakatastrophe vergessen wie einst das Waldsterben?
Ist es also richtig, die heftigen Diskussionen um die Erwärmung der Erdatmosphäre als das anzusehen, was viele vermuten: eine entbehrliche Belastung der Industrie und eine Verwirrung der Politik? Eine Verschwörung von Kernenergie, Wendepropheten und Naturphilosophen?
Nein! Dass die Menschheit regelmäßig vermeiden konnte, hart an Grenzen der Natur aufzuprallen, hat gerade damit zu tun, dass sie ihnen ausweichen konnte und nicht geradlinig darauf losfuhr. Wer darauf besteht, dass alles so bleibt wie gewohnt – Energiequellen, Rohstoffe, Investitionen, Technologien – trägt tatsächlich zu einer Klimakatastrophe bei. Im Weltmaßstab ist es zwar ziemlich unbeachtlich, ob wir in Europa Müll trennen und stromfressende Elektrogeräte austauschen, weil es effizientere gibt. Aber es ist nicht unbeachtlich, dass China oder Indien die Individualmotorisierung forcieren und dass in den USA noch immer absurd schlechte Energiekoeffizienten in den Fertighäusern der Suburbs üblich sind.
Es ist also kein Naturgesetz, dass der Menschheit immer gerade dann Alternativen zur Verfügung stehen, wenn der bisherige Weg nicht mehr gangbar ist. Die Menschheit kann sich Gleichgültigkeit gegen die Umwelt nicht leisten, und mehr oder minder fatale Zusammenstöße mit der Endlichkeit der Umwelt werden nicht automatisch vermieden. Der Pferdemist in den Straßen war kein Thema mehr, als das Auto kam, und als Tausende davon täglich den Weg zur Arbeit verstopften, begann man auf öffentliche Verkehrsmittel und Telekommunikation auszuweichen.
Wird das beim Klimawandel auch gelingen?
Ja und nein. Entschuldigung für meine Unsicherheit. Die Antwort hängt davon ab, ob rasch genug alternative Energien eingesetzt werden können, ob der Klimawandel nicht vielleicht sogar exponenziell zunimmt. Ist die Erwärmung, die wir heute beobachten, nicht etwa gar der verzögerte Effekt früherer industrieller Entwicklungsstadien? Dafür werden auch rabenschwarze Begründungen angeboten. Beides ist noch nicht ausgeschlossen.
Die Menschheit, speziell die famose Wirtschaftswissenschaft, brauchte für die Erkenntnis, dass die Erde nicht genug Kapazität für die Lagerung der „Abfälle“ aller Aktivitäten haben könnte, länger als für die Thesen von der Begrenztheit der Rohstoffe. Aber Klimaerwärmung durch den Treibhauseffekt ist nichts anderes als das Ergebnis der Lagerung der Endprodukte aller Aktivitäten in der Deponie „Atmosphäre“.
Die Menschheit arbeitet daran, das zu vermeiden und zu reduzieren. Mit Durchbrüchen zu anderen als fossilen Energieträgern kann das gelingen. Sonne, Wasserkraft, Wind oder Meeresbewegungen könnten das. Ob das rechtzeitig gelingt, bevor die Klimasituation unhaltbar wird, kann man heute nicht mit Sicherheit wissen. Die Entwicklung des Erdklimas, insbesondere auch in den Ozeanen, gibt noch einige große Rätsel auf.
Wie viel ist genug?
Zurück zum Wirtschaftswachstum: Wäre es nicht ohnehin vernünftig, den zunehmenden Verbrauch der Menschheit zu stoppen, auf Wirtschaftswachstum zu verzichten? Wie viel ist genug? Das lässt sich nicht eindeutig beantworten. Führen wir uns vor Augen: Millionen Menschen können nicht menschenwürdig leben, sind von Hunger, Elend und schrecklichen Mächten bedroht. In unserer Weltgegend haben wir einen beachtlichen Lebensstandard erreicht. Aber viele müssen sich Sorgen machen um die Vorsorge für das Alter, die steigenden Kosten von Pflege und Gesundheit. Wirtschaftswachstum entschärft soziale Gegensätze. Ob wir schon genug haben, hat auch mit Ethik und Christentum zu tun.
Wirtschaftswachstum ist nicht gleich Wirtschaftswachstum
Also doch Wirtschaftswachstum, um die Wirtschaftsflaute zu überwinden? Ja, natürlich. Aber: welches Wirtschaftswachstum? Das ist ein vieldeutiger Begriff: Arbeitsparendes oder Arbeitbrauchendes, Energie und Umwelt sparendes oder brauchendes Wachstum? Bisher beobachten wir eine allmähliche Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und Umweltverbrauch. Auf diesem Weg liegt sicher die Zukunft. Ein Prozent Wirtschaftswachstum ist nicht mehr mit einem Prozent Steigerung der eingesetzten Energie gekoppelt wie früher, sondern noch mit einem halben Prozent, und mit einem Viertelprozent Steigerung des Ausstoßes an Treibhausgasen.
Wirtschaftswachstum bei konstantem Einsatz von Energie und anderen Rohstoffen? Klingt plausibel. Aber das würde nicht genügen, der Verbrauch müsste sinken. Dennoch stimmt nun immerhin die Richtung. Unbegrenzt ist im Prinzip die Strategie, nicht mehr Materie zu verbrauchen, nicht wachsende Mengen an Produkten, sondern höherwertige. Nicht mehr Materie, sondern mehr Ideen. Der Weg ist gangbar, aber steil.

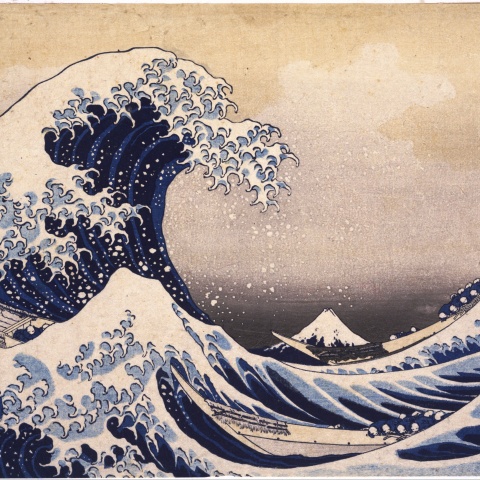










Kommentare