
Keine Angst vor Latein
Und ganz oben, am Ende der Straße, da wohnte ein Professor – ein Botaniker. Zu dem hat mich mein Vater immer geschickt, wenn er eine Pflanze nicht gekannt hat. Der Professor hat dann die Pflanze bestimmt und mir den lateinischen Namen genannt. Aber ich habe die Namen nie verstanden, ich konnte doch kein Latein. Bis ich wieder daheim war, hatte ich sie schon wieder vergessen …
Durch Jahrhunderte waren die Klöster die Wahrer des Wissens. In ihnen trafen sich Gelehrte aus aller Herren Länder. Die verbindende Sprache war die Sprache der Liturgie, die Sprache des antiken Roms: Latein. Es war für alle gleich fremd, eine neutrale Sprache, die keine Nationalität bevorzugte. Als sich die Wissenschaft langsam von der Religion löste, als die ersten Universitäten gegründet wurden, blieb Latein das verbindende Element. Die Zahl der Naturwissenschaftler war klein, die Entfernungen groß, und Sprachgrenzen vertieften die Gräben. Wer in der Fachwelt bekannt werden wollte, musste in Latein korrespondieren.
Der Begründer der modernen Biologie, Carl von Linné, brauchte daher keine Sekunde überlegen, wie er Pflanzen und Tiere über alle Sprachbarrieren hinweg benennen sollte. Natürlich kannte er die Namen, mit denen die Bauern die Lebewesen in ihrem unmittelbaren Umfeld belegt hatten. Doch manche Namen wurden schon im Nachbardorf anders ausgesprochen, und nur wenige Kilometer weiter waren sie bereits unbekannt. Für eine international verbindliche Benennung waren sie denkbar ungeeignet. Als ebenso unbrauchbar erwiesen sich die zu seiner Zeit unter Gelehrten üblichen Bezeichnungen: Die wichtigsten Eigenschaften wurden (natürlich lateinisch) benannt und aneinander gereiht. Doch es gab weder Richtlinien, in welcher Reihenfolge dies zu geschehen hatte, und auch nicht, welche Eigenschaften als diagnostisch wertvoll zu betrachten waren.
Linné definierte daher bereits Mitte des 18. Jahrhunderts: Die Namen aller Lebewesen sollten aus zwei Teilen bestehen (Gattungs- und Artname), und beide Teile waren dem Latein so weit wie möglich anzunähern. Darüber hinaus hatte er seinen Forscherkollegen kaum Grenzen gesetzt. Trotzdem sollte es lange dauern, bis seine Richtlinien allgemein akzeptiert und normiert waren. In der Zoologie einigte man sich 1905 auf ein internationales Regelwerk, und der erste verbindliche Code für die Botanik wurde gar erst 1930 beschlossen. Die Grundforderungen Linnés aber blieben bestehen.
Fast alles kann in einen wissenschaftlichen Tier-, Pflanzen- oder Pilznamen einfließen. Helden der Mythologie sind ebenso zu finden wie auffallende Eigenschaften oder der Ort des ersten Fundes. Auch einer verdienten Persönlichkeit kann ein Name gewidmet sein, nur nach sich selbst darf ein Wissenschaftler eine neue Art nicht benennen. Die Regelwerke lassen der Fantasie freien Lauf. Eine einzige Forderung besteht: Die Bezeichnungen müssen latinisiert werden. Es sind also Namen, willkürlich gewählt nach persönlichen Vorlieben. Weder ein geheimes Wissen ist in ihnen codiert noch sonst eine tiefere Bedeutung. Denken wir doch an unsere eigenen Namen: Ernst Schuster bezeichnet weder den Charakter noch den Beruf des Namensträgers – dieser kann durchaus ein fröhlicher Chirurg sein!
Und trotzdem macht es Spaß, den Bezeichnungen auf den Grund zu gehen. Der prächtige Tagfalter, den wir als „Admiral“ kennen, heißt wissenschaftlich Vanessa atalanta. Die Gattung Vanessa wurde 1807 nach dem weiblichen Vornamen benannt, der wiederum auf den Schriftsteller Jonathan Swift zurückgeht. Swift verwendete ihn als Deckname für seine heimliche Geliebte. Der von Linné 1857 vergebene Artbeiname atalanta stammt aus der griechischen Mythologie. Atalante war eine amazonenhafte Jägerin. Obwohl sie immerwährende Jungfräulichkeit geschworen hatte, willigte sie in eine Heirat ein, falls der Freier sie im Wettlauf besiegte. Erst durch göttlichen Beistand gelang dies einem der Brautwerber. Schönheit und Schnelligkeit finden sich also im wissenschaftlichen Namen des Wanderfalters, der alljährlich die Alpen überquert.
Agonopterix cluniana heißt ein Kleinschmetterling, der erst im Jahr 2000 aus Riedwiesen im Rheintal und Walgau beschrieben wurde. Der Artbeiname cluniana verweist auf die römerzeitliche Siedlung Clunia, die auf der antiken Straßenkarte Tabula Peutingeriana unweit von Bregenz verzeichnet ist. Nachdem lange über ihre Lage spekuliert worden war, konnte Clunia schließlich 1998/99 in Feldkirch-Altenstadt verortet werden – kurz vor der Entdeckung des Falters in derselben Region. Die Siedlung verhalf auch einer ausgestorbenen Tierart zu ihrem Namen: Cluniaster rhenanus ist ein Seeigel der Kreidezeit, der 1933 aus Feldkirch beschrieben wurde. Der Artbeiname rhenanus würdigt die Nähe des Fundorts zum Rhein.
Leymeriella fusseneggeri – ein Ammonit der Kreidezeit – schließlich ist nach zwei Forschern benannt: Alexandre Félix Gustave Achille Leymérie (1801–1878) war Professor an der Fakultät für Mineralogie und Geologie der Universität Toulouse. Siegfried Fussenegger (1894–1966) ist in Vorarlberg als Museumsgründer bekannt. Seine Fossiliensammlung bildet noch heute den Grundstock der wissenschaftlichen Sammlungen der inatura in Dornbirn.
Keine Geheimwissenschaft verbirgt sich also hinter den „lateinischen“ Namen. Sie sind willkürlich gewählt und ermöglichen die Kommunikation über Sprachgrenzen hinweg. Doch sie sind ungewohnt, nicht immer leicht zu merken, und werden daher von Amateuren und Laien gemieden – zu Unrecht, denn sie helfen, Missverständnisse zu vermeiden.

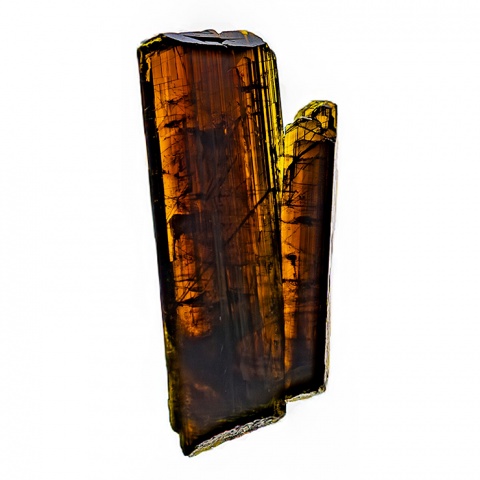









Kommentare