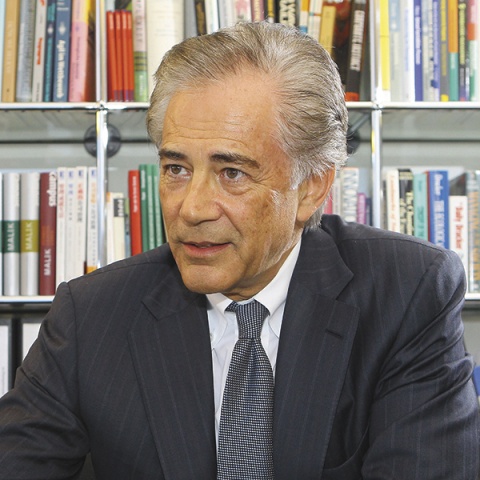
„Die alte Welt löst sich auf, die neue nimmt Gestalt an“
Fredmund Malik (71), Wirtschaftswissenschaftler und einer der renommiertesten Managementexperten Europas, sagt im Interview mit „Thema Vorarlberg“, dass „wir heute den Übergang zu einer hochkomplexen Gesellschaft erleben“. Der gebürtige Lustenauer Malik, Bestsellerautor und Institutsleiter, über den einstigen Niedergang der Vorarlberger Textilindustrie, die fatalen Folgen von kurzfristigem Denken – und die Notwendigkeit, ein Leben lang neugierig zu bleiben.
Sie haben sich viel mit der Finanz- und Wirtschaftskrise beschäftigt und gehörten damals zu den Wenigen, die bereits vor dem Jahr 2008 vor einem Zusammenbruch der Systeme gewarnt haben.
Man konnte das schon frühzeitig angesichts der zunehmenden Verschuldung erkennen. Wirtschaftswachstum wurde durch immer größere Schulden erkauft. Das Verhältnis von Wirtschaftsleistung zu ausstehenden Krediten wurde permanent schlechter. Zudem ist der Großteil dieser Kredite nicht in die Realwirtschaft, also nicht in Fabriken, Patente, Produkte und Investitionen, sondern in die Finanzwirtschaft geflossen. Obwohl die wirkliche Wertschöpfung in der Realwirtschaft stattfindet, hat die Finanzwirtschaft vom Volumen her die Realwirtschaft beinahe verdrängt. Und im Finanzwesen sind gleichzeitig immer noch kreativere und riskantere Produkte entstanden. Die Krise war vorprogrammiert, schon in den 1990er-Jahren.
Die Krise, sagten Sie einst, sei nach dem Motto bekämpft worden: Schnaps für den Alkoholiker. Gilt das auch heute noch?
Ja, dieses falsche Motto gilt noch immer. Es gibt noch mehr Schnaps für die Wirtschaft. Die Probleme sind in andere Erscheinungsformen verlagert worden, man hat viele Gläubiger retten müssen, indem man die Schulden der Schuldner übernommen hat, teils durch neue Garantien, teils durch neue Kreditschöpfung. Man hat vieles versucht. Aber letztlich haben wir heute eine deutlich höhere Verschuldung als zu Zeiten Lehman!
Sie schreiben in Ihrem Buch „Navigieren in Zeiten des Umbruchs“, dass die alte Welt sich aufzulösen beginnt und die neue Welt Gestalt annimmt. War die Krise der Beginn dieses Wandels? Oder nur ein Symptom?
Sie war ein Zwischenstadium. Heute sind tiefgreifende Veränderungen in Technologie, Demografie, Ökologie und Ökonomie, auch in den sozialen Wertestrukturen, bereits weit fortgeschritten. Die Systeme haben sich zu vernetzen begonnen. Die alte Welt löst sich auf, die neue nimmt Gestalt an. Bisheriges wird durch Neues verdrängt. Arbeiten, Lernen, Kommunizieren, selbst das Leben – alles wird sich ändern. Wir stehen in einem Prozess, der mit dem einstigen Wechsel von der Agrar- zur Industriegesellschaft vergleichbar ist. Wir erleben heute den Übergang zu einer hochkomplexen Gesellschaft.
Sie schreiben, dass die Häufung der Nein-Sager ein Indiz für diesen Umbruch sei. Inwiefern?
Die Menschen spüren, dass sich in immer mehr Bereichen der Gesellschaft Grundlegendes ändert, und dass es irreversibel sein wird. Aber die meisten können sich keinen Reim darauf machen. Leute, die früher alles probiert haben und sich nicht hindern haben lassen, gehören heute zum Lager der Nein-Sager. Ich verstehe diese Menschen. Was einmal richtig war, ist plötzlich falsch. Vieles geht nicht mehr, weil wir mit den bisherigen Verfahren an die Grenze des Möglichen stoßen. Als müsste man mit dem Fahrrad auf der Autobahn fahren! Aber gerade jetzt braucht es Pioniere. Wir müssen dieses Nein, diese Barriere, sehen und verstehen – aber wir dürfen nicht stehenbleiben. Die Menschen müssen allerdings erst lernen, damit umzugehen. Denn mit den alten Mitteln, mit den alten Verfahren und Methoden, wird diese neue Komplexität nicht mehr beherrschbar sein.
Steuern wir in vollkommen Neues? In eine heute noch unbekannte Welt?
Es werden Reste bleiben. Aber mein Vorschlag ist, davon auszugehen, dass wir uns bereits heute in einer weitgehend unbekannten Welt befinden. Und die Herausforderungen nehmen weiter zu. Es hat keinen Sinn, diesen Prozess stoppen zu wollen. Vielmehr muss man die Chancen nutzen, die diese neue Welt bietet. Ein Beispiel: Wer heute noch einen Papierkalender hat, sollte dann doch einmal ein paar Wochenenden lang trainieren, mit seinem Handy einen Kalender zu führen, auch wenn das Ganze zunächst vielleicht kompliziert erscheint. Um das auf alte Zeiten zu projizieren: Mit dem Pferd war man vertraut. Mit dem Auto nicht. Man begegnete damals und begegnet heute neuen Technologien mit Zweifeln. Man fügt sich, aber man fügt sich widerstrebend. Man kämpft gegen die Komplexität, statt sie zu nutzen. Das ist eine stark sichtbare Verhaltensweise.
Anpassen. Oder zurückbleiben. Kann man diese Lehre ziehen?
Richtig. Man hat noch mit Pferdefuhrwerken gearbeitet, als es schon Autos gab. Eine Zeitlang ging das ja noch halbwegs gut. Aber irgendwann sind die Pferdefuhrwerke verschwunden. Man kann zu früh sein, aber viel gefährlicher ist es, zu spät zu sein. Das Hauptproblem ist die Kurzfristigkeit des Denkens und Handelns, die auf Kosten des langfristigen Horizonts geht, den wir heute für viele Entscheidungen brauchen. Man hat das Wirtschaften in Theorie und Praxis lange Jahre nur in Geldgrößen gemessen und nur auf die kurzfristigen Gewinne geschaut. Natürlich braucht man das. Aber die Qualität einer langfristigen Strategie kann man nicht an den Gewinnen ablesen. Man muss viel weiter in die Zukunft schauen! In Branchen wie der Energiewirtschaft, der Digitalisierung, der Industrie 4.0, im Bereich der Biowissenschaften, in vielen anderen Bereichen braucht man langlebige Investitionen. Um ein Medikament zu entwickeln und marktreif zu machen, braucht man typischerweise 10 bis 15 Jahre. Und wenn man da nur auf die Quartalsgewinne oder die Jahresgewinne achtet, ist man blind gegenüber diesen zwingend notwendigen langfristigen Entwicklungen. Diese Kurzfristigkeit der Navigationssignale, diese Irreführung durch die vorhandenen Navigationssysteme, das ist fatal. Salopp gesagt: Wer auf der Autobahn nur zehn Meter Sicht hat, wird die nächste Kurve nicht erkennen!
In der zunehmend beschleunigten Welt wäre ein Schritt zurück, die Besinnung auf längerfristiges Denken, also der richtige Weg?
Ja. Unbedingt! Je schneller sich die Welt bewegt, umso weiter muss man in die Zukunft schauen können. Auch wenn diese Zukunft noch im Nebel liegt, muss man dorthin schauen und sich auch an schwachen Signalen orientieren.
Was viele Menschen in der globalisierten Welt erschreckt, ist für Sie eine Chance: die Komplexität. Warum?
Man darf kompliziert und komplex nicht verwechseln. Bürokratie ist kompliziert. Die Natur ist komplex. Komplexität kann ein riesiges Hindernis sein, sie macht den Menschen Angst. Und dann versuchen die Menschen, diese Komplexität zu reduzieren. Das geht heute aber nicht mehr, weil die Systeme vernetzt sind. Was China macht, muss uns heute interessieren! Es kann uns nicht mehr gleichgültig sein, was in Griechenland passiert! Es hat uns zu interessieren, was in der Digitalisierung oder in der Biologie geschieht! Komplexität ist zu begrüßen und zu nutzen. Im Übrigen glaubt man immer, dass komplexe Herausforderungen auch komplexe Lösungen haben müssen. Das stimmt nicht. Die genialen Lösungen sind die, in der man einfache und elegante Lösungen für komplexe Probleme findet. Denken Sie nur an den Kreisverkehr! Die Steuerungsintelligenz wird zum Autofahrer verlagert, der hat zwei Regeln zu befolgen, das Ganze funktioniert in seiner Schlichtheit besser als diese komplizierten, computergesteuerten Ampeln.
Sie schreiben von Substitution und kreativer Zerstörung – und davon, dass aus Altem auch Neues und Gutes entsteht …
Ja, nach gewissen Übergangsphasen, durch die man durch muss. Es kommt etwas Neues, mit größeren Potenzialen. Dafür muss das Alte weichen. Der österreichische Ökonom Josef Schumpeter hat das kreative Zerstörung genannt. Reste können erhalten bleiben, aber das Neue ist – wenn diese Prozesse einmal eingesetzt haben – nicht mehr aufzuhalten. Denken Sie nur an die Technologie! Und deswegen ist es gut, wenn man sich rasch darauf einstellt, sich rasch damit vertraut macht und damit auch die bisherigen Grenzen hinter sich lässt. Wenn man Wandel managen muss, glaubt man im Übrigen, man müsse zuerst den Menschen ändern. Meine Denkrichtung ist eine andere: Gib den Menschen neue Methoden und neue Werkzeuge, dann müssen sie sich gar nicht ändern. Das typische Beispiel ist das Handy. Die Menschen mussten sich nicht ändern. Sie bekamen nur ein neues Werkzeug. Nach diesem Modell sind Reformen schnell und zielgerichtet möglich. Weil auch die Angst der Menschen wegfällt, sich ändern zu müssen.
Kreative Zerstörung. Kann da die Textilindustrie in Vorarlberg als Beispiel dienen, die zerfiel – und einer unglaublich vielschichtigen Wirtschaft Platz gemacht hat?
Das ist ein solches Beispiel. Manche haben die Zeichen früh erkannt und reagiert. Und andere glaubten, alles bleibe, wie es ist. Ich bin in Lustenau aufgewachsen. Dort war die Stickerei-Industrie wichtig. Man hat viel nach Japan exportiert. Und dann wollten die Japaner auf einmal selbst die Maschinen. Also gab es Pioniere, die den Japanern das Know-how geliefert und deren Leute ausgebildet haben. Diese Fabrikanten wussten, dass sie sich den eigenen Ast absägten. Aber sie wussten auch, dass der Prozess nicht mehr zu stoppen gewesen wäre! Die Veränderung würde stattfinden, so oder so, mit ihnen oder ohne sie. Fortschrittliche Stickerei-Fabrikanten erkannten die Zeichen der Zeit: Ersetze dich selbst, bevor es ein anderer tut! Man musste diesen Dingen ins Auge sehen und sich rechtzeitig anpassen. Das Ergebnis war letztlich die Verdrängung der Textilindustrie in Vorarlberg – und die Tatsache, dass die Vorarlberger Wirtschaft heute unglaublich vielschichtig ist. Es ist eine blühende Wirtschaft in diesem kleinen Land. Da kann man nur stolz sein. In Vorarlberg ist der Fortschritt tatsächlich genutzt, zum Teil sogar selbst gemacht worden.
Und was raten Sie Vorarlberger Unternehmern mit Blick auf die noch unbekannte Zukunft?
Sich ganz intensiv mit der Digitalisierung zu befassen! Industrie 4.0 wird die Art, wie wir produzieren, konsumieren, kommunizieren verändern, wird die Art zu lehren und zu lernen verändern. Und die Biowissenschaften werden das Ihre dazu tun, wahrscheinlich noch viel stärker, als sich heute voraussehen lässt. Ich empfehle Unternehmern noch etwas: Besucht die Orte in der Welt, an denen die Veränderungen entstehen! Man kann vieles durch Marktforschung erfahren. Aber der persönliche Augenschein ist durch nichts zu ersetzen. Ständig nur vor einem Computer zu sitzen, vor einem leblosen Bildschirm, in dem das Abstrakte regiert, lässt die Intuition sterben. Trotz aller Vorteile führen die elektronischen Medien zu einer gewissen geistigen Verarmung. Wer heute dagegen nach – beispielsweise – Peking geht, wird Situationen erleben, die es am Vortag noch nicht gegeben hat. Man muss diese Veränderungen, diese Vorboten der neuen Welt sehen, spüren, erleben! Seid der Witterung voraus! Und noch etwas: Unternehmer müssen ganz nah am Kunden sein! Aber sie dürfen sich nicht darauf verlassen, dass die Kunden von heute noch die Kunden von morgen sein werden.
Wer wird denn Leader in den neuen Zeiten sein?
Das werden jene Menschen sein, die eine natürliche Neugier haben, die sich für die Welt interessieren – und auch deswegen im Geiste jung bleiben. Wer nicht mehr neugierig ist, baut sehr schnell ab. Auch wenn jemand, nach Jahren gerechnet, jung sein mag, ist im Denken alt, wer nicht mehr neugierig ist – während umgekehrt Menschen, die in die Jahre gekommen sind, jung bleiben, indem sie sich diese Grundneugier des Lebendigen bewahren. Genau deswegen muss man sich auch ein Leben lang fortbilden. Wer sich alle zwei, drei Jahre ein neues Interessengebiet erschließt – Kunst, Geschichte, fremde Länder, was auch immer – bleibt jung. Und noch eine Art von Leadern wird es geben – jene, die herumprobieren und experimentieren, jene, die nach neuen Lösungen suchen.
Ergo wäre es der größte Fehler, saturiert zu sein. Der Mensch soll neugierig bleiben?
Genau. Es geht einem gut, man glaubt, es gehe immer so weiter. Es war in der Geschichte stets der Fall, dass der Glaube, man habe eine Welt geschaffen, die so bleiben wird, gleichzeitig den Untergang dieser Welt ankündigt hat. Mein Appell lautet: Sei dem Wandel voraus!
Vielen Dank für das Gespräch!














Kommentare