
Die digitale Flut
„Die Wellen reiten oder von der Flut überrascht werden“ – so der Titel einer Zukunftsanalyse des Weltbibliothekenverbandes IFLA. Wenn Bibliotheken sich demnach nicht rasch auf die neuen Herausforderungen einer digitalen Informationsumgebung einstellen, könnte das ihr Ende bedeuten. Gleichzeitig würde dann auch der freie Informationszugang für alle der Vergangenheit angehören.
Taucht im Alltag eine Fragestellung auf, googeln wir und haben sofort Informationen. Allerdings ist die Treffermenge unüberschaubar und das Ranking nicht nachvollziehbar. Oft übernehmen wir die gefundenen Ergebnisse unkritisch. Ein Beispiel: Zum Suchbegriff „Vorarlberg“ kommen in 0,32 Sekunden 25.000.000 Treffer: Zuerst finden wir ein paar Überblicksseiten, dann ein Sammelsurium an Informationen, deren Qualität höchst unterschiedlich ist. Differenzierte Suchmethoden, die Google durchaus anbietet, sind kaum bekannt und werden von den wenigsten genutzt.
Ein anderes Beispiel: Gibt man einen inhaltlich sensibleren Suchbegriff wie „Juden“ oder „Islamischer Staat“ ein, stößt man zudem noch auf viele Seiten mit fragwürdigem Inhalt, hinter denen verschiedene gesellschaftliche, politische, kommerzielle und manchmal auch extremistische oder sogar rassistische Interessen stehen. Die Ergebnisse richtig einschätzen zu können, benötigt ein hohes Maß an Informationskompetenz und Erfahrung.
Der Versuch der Bibliotheken, Leserinnen und Lesern zuverlässige und überprüfbare Informationen anzubieten, sowie die damit verbundenen Schwierigkeiten lassen sich am E-Book-Angebot der Vorarlberger Landesbibliothek anschaulich demonstrieren. Die Bibliothek kauft eine stetig steigende Zahl an elektronischen Büchern und Zeitschriften, mit dem Ziel, diese möglichst ohne Einschränkungen einer großen Leserschaft zugänglich zu machen. Die Inhalte stammen von namhaften Autoren, wurden einem Lektorat unterzogen und sind datiert. Sie können zitiert und daher auch für berufliche und wissenschaftliche Zwecke genutzt werden. Von Anfang an aber stoßen Bibliotheken an Grenzen, die sie daran hindern, freien Zugang zu diesen Inhalten zu gewähren.
Die Ursachen dafür sind einerseits finanzieller Natur. So kommt es etwa oft vor, dass ein wissenschaftliches E-Book an Bibliotheken zehn Mal so teuer verkauft wird wie das traditionelle gedruckte Buch.
Andererseits ist die herrschende Rechtslage bezüglich digitaler Medien ein großes Problem. Manche Verlage sehen Bibliotheken als unliebsame Konkurrenten und sind der Meinung, dass sie als Rechteinhaber selbst entscheiden können, ob sie Zugang zu einem bestimmten Werk gewähren und wie die Geschäftsbedingungen für einen solchen Zugang auszusehen haben.
Sollte diese urheberrechtliche Ausgangslage Bestand haben, wäre die Folge, dass verstärkt in erster Linie die Verlage und nicht mehr die Bibliotheken über die Zugangsbedingungen zu digitalen Beständen in den Bibliotheken entscheiden.
Die Aufgabe der Bibliotheken, demokratisch allen Bevölkerungsschichten – unabhängig vom Einkommen – freien Zugang zu Informationen, Wissen und Kultur zu garantieren, ist daher ernsthaft gefährdet. Die Verschiebung der rechtlichen Möglichkeiten ist namhaften Medienwissenschaftlern zufolge der Ausdruck eines asymmetrischen Kräfteverhältnisses zwischen einer ressourcenschwachen Lobby für Grund- und Verbraucherrechte und der hochprofessionellen Interessenvertretung der IT-Giganten. In diesem Fall sind es weltweit agierende, monopolistische Verlage, die mit schwindelerregenden Preisen die Budgets der Bibliotheken belasten. Der europäische Dachverband der nationalen Bibliotheksverbände (EBLIDA) fordert daher eine rasche Beseitigung der urheberrechtlichen Defizite, um Bibliotheken die geforderten Rechte zuzusichern. Dringend notwendig wäre daher ein präzises Urheberrecht, welches es den Bibliotheken erlaubt, wie bei gedruckten Büchern uneingeschränkt E-Books zu kaufen und zu verleihen und dafür den Autoren eine angemessene Vergütung zu erstatten. Eine derartige Anpassung ist allerdings nur über eine Gesetzesänderung der Europäischen Union, die dann in österreichisches Recht umgesetzt wird, möglich. Die österreichischen Büchereien und Bibliotheken haben sich daher der europäischen Initiative „The right to E-read – Legalize it“ angeschlossen.
Insgesamt ist zu beobachten, dass auch die zunehmende Digitalisierung bestehender Bibliotheksbestände zwar einerseits große Vorteile für die Leser bringt, andererseits aber große rechtliche und organisatorische Herausforderungen auf die Bibliotheken zukommen. Traditionelle Informationsketten (Urheber – Verlag – Vertrieb – Buchhandel – Bibliothek – Leser) sind immer mehr in Auflösung begriffen und müssen durch neue ersetzt werden. Die „Vision 2025“ der Österreichischen Nationalbibliothek unterstreicht diese Notwendigkeit, denn sie geht davon aus, dass in zehn Jahren kaum noch Bücher auf Papier erscheinen werden, wogegen derzeit allerdings noch alle Produktionsstatistiken der internationalen Buchmessen sprechen.



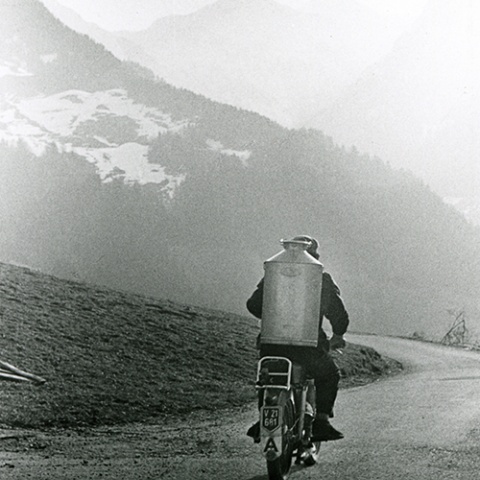
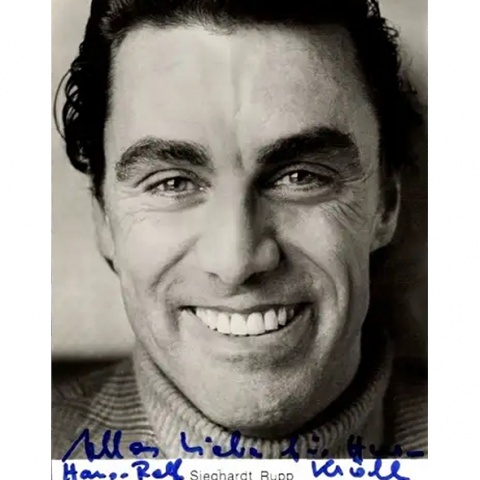







Kommentare