Es geht uns gut
Ein wenig Ferien und Abschalten über den Sommer haben gutgetan. Ob blühende Wiesen auf unseren Bergen mit dem Gebimmel des Viehs auf der Alp, ob im Palast des Kaisers von China, am Bregenzer Seeufer, beim tödlichen Versuch, Turandot umzustimmen, oder auch, entspannter als im übrigen Jahr, frühstückend im Kreis der Familie: Da mag schon das Gefühl aufkommen, dem Arno Geiger in seinem Roman den Titel gab „Es geht uns gut“.
Schalten Sie bloß beim Frühstück nicht den Fernseher ein! Der könnte Ihnen die Stimmung verderben. Was musste man da alles zur Kenntnis nehmen: die Wahnsinnstat an der Uferpromenade von Nizza am 14. Juli (wenn’s „nur“ Wahnsinn gewesen wäre!), Attentate in Paris, Istanbul und München und in einer Dorfkirche in der Normandie, ganz abgesehen von Ankara, Bagdad und Kabul, Bomben, die Flugzeuge mit Urlaubern sprengen, Tausende auf der Flucht im Mittelmeer Ertrunkene, die Auslöschung allen Lebens in Aleppo, einer der ältesten Städte der Welt. Nicht genug: Brexit und das mögliche Auseinanderbrechen Großbritanniens, die Absagen an europäische Solidarität aus einigen östlichen Nachbarländern. Da wiegt es weniger schwer, dass wir in Österreich noch einmal den Bundespräsidenten wählen müssen und dass das österreichische Olympia-Team gerade nur eine Medaille gewonnen hat.
Geht es uns gut? Die Wirtschaftsforscher sagen Österreich für 2017 wieder „stärkeres Wachstum in einem risikoreichen Umfeld“ voraus: +1,7 Prozent (WIFO), veröffentlicht allerdings gerade am Tag der Brexit-Abstimmung mit dem unerwarteten Ausgang. Die gute Konjunktur in Deutschland werde sich fortsetzen, gehe jedoch „in die zweite Halbzeit“ (IFO München), die Schweizer Wirtschaft erhole sich „verhalten“ (Seco), die Abschwächung in den USA hält an, wobei die Unsicherheiten der Präsidentenwahl eine Rolle spielen. Eine „normale“ Kapazitätsauslastung und Vollbeschäftigung hat gerade nur Deutschland erreicht. Das hat freilich mit schweren Ungleichgewichten in der Währungsunion zu tun. Es deutet auf deren anhaltend fragile Lage hin und auf die seit Langem mitgeschleppten wirtschaftspolitischen Differenzen zwischen Deutschland und seinen wichtigsten Partnern Frankreich und Italien.
Der Finanzkollaps 2007/2008 signalisierte den Beginn einer neuen Epoche. Die Weltwirtschaft ist in eine Zeit sehr mäßiger Wirtschaftsdynamik eingetreten. Die Verhältnisse des 21. Jahrhunderts begannen mit Schrecken und Verunsicherung. Der fast tägliche Horror und die Überlastung der natürlichen Umwelt sind die Folgen von Kurzsichtigkeit. Sie gehen letztlich auf ein gedankenloses „Es geht uns gut“ zurück. Das wollte nicht wahrhaben, dass die Probleme der Afghanen oder der Syrer auch unsere Probleme sind, spätestens, wenn sie dort unerträglich werden. Wenn wir kein Programm finden, ihnen dort massiv und nachhaltig zu helfen, dann kommen sie eben – vertrieben vom Krieg und getrieben von Hoffnungslosigkeit – persönlich zu uns, und dann ist es unser Problem.
Die neue Epoche basiert auf fundamental veränderten Verhältnissen: Der Verbrauch von Ressourcen der natürlichen Umwelt stößt tatsächlich an Grenzen. Uns in den Alpen kostet die Änderung des Klimas gerade nur das Schmelzen von Gletschern und Schipisten, weiter südlich aber, in Afrika, bedeutet das Klima das Austrocknen der Weiden, Unterernährung und Hungertod.
Bisher fand die Menschheit noch immer Alternativen, wenn dann und wann Ressourcen knapp wurden. Es geht uns auch weder das Öl noch die Kohle aus, wie vielfach befürchtet. Nicht in den nächsten paar hundert Jahren. Weit mehr als selbst eine wachsende Erdbevölkerung je benötigen würde, liefert uns die Sonne ein Vielfaches an Rohenergie. Der Ersatz der fossilen Brennstoffe ist nicht deswegen dringend, weil sie knapp werden, sondern weil die Klimaentwicklung uns zwingt, sie durch erneuerbare Energien zu ersetzen. Damit steht die Menschheit unter Zeitdruck.
Das zweite Merkmal der Epochenwende hängt mit dem ersten zusammen: Die Menschheit ist in ein Zeitalter eingetreten, in dem das Zusammenleben grundsätzlich globale Dimensionen hat. Aus beiden historischen Stufen ergibt sich ein sehr komplexes Geflecht an Zusammenhängen, die wir offenbar derzeit kaum durchschauen, analysieren und noch weniger steuern können. Die Herausforderungen, denen die moderne Gesellschaft gegenübersteht, entstehen aus der Globalisierung der Probleme und aus dem fehlenden Einvernehmen über globale Problemlösungen. Letztlich kämpft die Menschheit mit der Komplexität von Problemen, die ihr Wissen, ihre Wissenschaft und ihre gesellschaftliche Organisation überfordern.
Daher rühren der Verlust des Vertrauens in das Finanzsystems, stark gestiegene und auf Dauer untragbare Staatsschulden, das Zurückschrecken vor Anpassungen des Sozialsystems an die Alterung und vor einem besseren Ausgleich zwischen den Älteren und der Jugend, wachsende Ungleichheit zwischen Reich und Arm, die Schwächung der Demokratie, schließlich Fanatismus, Brutalität und riesige Ströme von Flüchtlingen auf der Suche nach einem besseren Leben. Es ist nicht mehr die exklusive Sache von Idealisten, spöttisch „Gutmenschen“ genannt, anzupacken und für zukunftsfähige Lösungen zu mobilisieren.
Aber hat die moderne Gesellschaft nicht die Mittel, die Probleme zu erleichtern? Macht sie nicht unerhörte Fortschritte beim Entwickeln und Nutzen neuer Technologien? Ist die neue Epoche nicht auch die Epoche des Internets, des schrankenlosen Wissens und der weltweiten Kommunikation?
Abgesehen davon, dass auch die heute verfügbare Technik schon enorm viel kann: Woran es eher fehlt als an noch tolleren Technologien, ist die Bereitschaft, die gesellschaftliche Organisation zu verbessern. Als vor einem Jahr Hunderttausende bei Wind und Wetter in unabsehbaren Marschkolonnen neben Autobahnen, auf Eisenbahngleisen, über Felder und Zäune sich nach Mittel- und Nordeuropa durchschlugen, hätte es ja nicht an Technik gefehlt, das menschenwürdig durchzuführen. Die Eisenbahn fährt seit hundertfünfzig Jahren, mittlerweile schnell und recht kommod. Es fehlte an politischer Bereitschaft und an Organisation.
Das spricht nicht gegen technischen Fortschritt. Wir brauchen aber ein Umdenken und Innovationen in unserem gesellschaftlichen Bewusstsein. Die großen Aufgaben, mit denen wir heute konfrontiert sind, dürfen auch nicht einseitig als Last und als Gefahren gesehen werden, die uns Wachstum kosten. Sie sind viel mehr ein Anstoß, neue und bessere Lösungen zu suchen. Wirtschaftlicher Fortschritt entsteht aus dem Erkennen und dem unternehmerischen Lösen von Problemen. „Alles Leben ist Problemlösen“ (Karl Popper). Das Jammern über die flaue Konjunktur hilft nicht. Sicher, in der neuen Epoche, die begonnen hat, wird vieles nicht so bleiben wie gewohnt und wie es bequemer wäre. Vielleicht fällt es schwer, das einzusehen, wenn es einem gutgeht. Wir müssen die Herausforderungen positiv und innovativ annehmen.
Der betagte französische Philosoph Michel Serres ruft der heutigen Jugend (2013) zu: „Erfindet euch neu! Ich wäre gern achtzehn, so alt wie ihr, die ihr mit dem Daumen über euer Smartphone wischt, in der heutigen Zeit, in der alles zu erneuern, ja erst noch zu erfinden ist.“

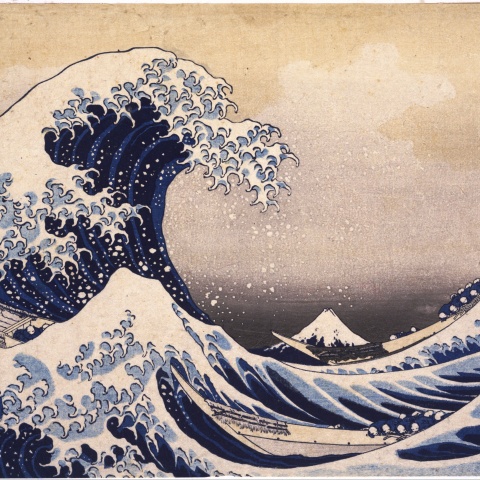











Kommentare