Pfingstwunder in unserer Zeit
Beinahe hätten sich die Österreicher schon an den substanz- und visionslosen Stil gewöhnt, den die Koalitionsparteien offenbar als Regieren verstanden wissen wollten. „Da erhob sich ein gewaltiges Brausen, und vom Himmel kam der Geist über sie: Sie waren doch aus verschiedenen Richtungen zusammengekommen und sprachen verschiedene Sprachen, aber sie verstanden auf einmal eine gemeinsame Sprache. Da fragten sie sich: Was soll denn daraus werden?“ (sinngemäß aus der Apostelgeschichte)
Sie versprachen sich, miteinander zu arbeiten statt gegeneinander, was bisher nur selten gelang. Die über Fernsehen dabei waren, versuchten dem Kanzler zu glauben, was er versprach, und der Geist veranlasste auch den Vizekanzler, in die ausgestreckte Hand der Zusammenarbeit einzuschlagen, und zu geloben: „I will.“ Längst sehr skeptisch geworden, ist das Volk Österreichs zweifelnde Gedanken nicht gleich los: Der wundersame Vorgang dieses Handschlags wirkt immerhin bewegend. Aber sind auch die, die noch immer meinen, heilige Kühe hüten zu müssen, auch bereit, ihre Ämter und Pfründen gegen Vorteile für das ganze Volk einzutauschen? Oder haben ihnen ihre jeweiligen Spin-Doktoren diesmal wirklich überzeugend geschildert, dass das Volk nun wirklich murre und auch nicht mehr ein paar Tage bereit sei, dieser Art des Regierens zuzuschauen. Sie warnen: Der schreckliche HC Strache müsse sich nur noch ein paar Wochenenden staatsmännisch gebärden, um bei der unvermeidlich kommenden Wahl die absolute Mehrheit zu erhalten.
Die schwer geprüfte Seele der Österreicher scheint von diesen Begebenheiten so beeindruckt, anzunehmen, die beiden Hirten und ihr Gefolge seien schon dabei, Ziele und Pfade abzustecken, die in eine erneuerte Regierungserklärung aufzunehmen wären.
Welche denn? Das haben ja die Regierenden bisher auch getan. Haben Sie, geschätzte Leser und Leserinnen, es sich jemals für eine Stunde vorgenommen, deren Text lesen zu wollen („Erfolgreich. Österreich.“ Wien, Dezember 2013)? Wenn ja, haben Sie die Lektüre sicher traumatisiert abgebrochen: Fast alles, was dort steht, hätte Ihre Unterstützung, aber bei der Verwirklichung muss etwas schiefgegangen sein. Eine solche Anhäufung von frommen Wünschen auf 112 Seiten könnten Sie ja ohne Weiteres unterstützen: Pensionen sichern, Mängel beseitigen, Arbeitsplätze schaffen. Oder, im Originaltext zur Verwaltungsreform: „Moderne, effiziente Verwaltung durch Implementierung von Benchmark-Systemen sowie weitere Kostendämpfung im Personal- und Sachaufwand“ (S.110). Und zum Steuersystem: „Strukturelle Mängel am bestehenden Steuersystem sind zu beseitigen, Lenkungseffekte sollen genützt und die Rechtssicherheit für Bürgerinnen und Bürger sowie die öffentliche Hand sichergestellt werden“ (S. 106). Löbliche Absichten, zu denen man in Wien sagt: „No na.“
Wo ist das Problem? Es geht nicht darum, was wünschenswert oder ohnehin selbstverständlich wäre. Es geht darum, wie man das angeht und erreichen will. Welche „strukturellen Mängel des Steuersystems“ konkret sollen behoben werden? Und wie? Fast alles, was dringend wäre, tut jemandem weh. Welche Vorteile hätten dann Reformen für das Land, wenn einmal auf etwas längere Sicht als bis zur nächsten Wahl kalkuliert würde? Und, da nahezu alle frommen Wünsche etwas kosten: Woher sollen die notwendigen Mittel dafür kommen?
Im gleichen Stil wird plakatiert: „Die Pensionen sind sicher.“ Warum soll das Volk das glauben? Es gibt aus naheliegenden Gründen nichts, das unsicherer wäre als Pensionen. Nur wer noch ans Christkind glaubt, fragt nicht, wie die nächste Generation dafür aufkommen soll. Weshalb wird dem Volk nicht erläutert, warum? Weil es nicht beunruhigt werden soll. Pardon: Diese Sorge ist grundlos. Das Volk ist längst beunruhigt. Je öfter betont wird, wie sicher die Pensionen sind, desto mehr.
Unsere Jugend glaubt ohnehin nicht mehr, dass sie einmal mit einer staatlichen Pension rechnen kann. Sie wird förmlich zum Fatalismus gezwungen. Aber so aussichtslos ist der Fall nun auch wieder nicht. Man könnte ja das Problem sachlich erläutern, statt es zum Tabu zu erklären und das Gutachten des Pensionsbeirats unveröffentlicht in der Lade verschwinden zu lassen. Man müsste natürlich erläutern, wie die Regierung auf die schwierige Perspektive zu reagieren gedenkt. Als die Leistungen der Pensionsversicherung in der Nachkriegszeit festgelegt wurden, nahm erstens die Wirtschaftsleistung der Volkswirtschaft jährlich rasch zu, heute stagniert sie. Die Lebenserwartung in Österreich hat, zweitens, um 14 Jahre zugenommen. Wenn am Jahr des Pensionsantritts nichts geändert wird, wird die Zeit des Ruhestands entsprechend länger und der Aufwand dafür teurer. Drittens: Heute geht eine überdurchschnittlich starke Generation – die Jahrgänge aus dem Baby-Boom der Nachkriegszeit – in den Ruhestand und eine um rund ein Drittel kleinere Generation muss die Pensionen der Eltern erwirtschaften. Übrigens, das weiß man seit einem Vierteljahrhundert.
Was tun? Da gibt es einige theoretische Möglichkeiten. Ein Tabu verhängen? Den Finanzminister schwitzen lassen? Neue Staatskredite in Zürich aufnehmen? Aber auch: Die derzeit vorgesehene Pensionssumme auf die zunehmende Zahl der Ruhestandsjahre verteilen, also pro Jahr zu senken? Für Frauen und für Männer das gleiche Alter des Pensionsantritts einführen? Gemach, eh nicht sofort, aber bis in zehn Jahren in kleinen Schritten? Oder vielleicht die Beiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu den Pensionen erhöhen? Die Leserinnen und Leser seien nun eingeladen, zu beurteilen, welche der obigen Optionen entweder ganz und gar nicht denkbar oder ziemlich unklug oder eben doch denkbar sind, möglichst mit sinnvollen Begleitmaßnahmen. Diejenigen, die den gegenwärtigen Stand des Sozialsystems unter Denkmalschutz stellen, sind in Wirklichkeit dessen Totengräber.
Nicht nur die Management-Erfahrungen des Regierungschefs geben Hoffnung, dass wir strategisch durchdachte und von Dogmatismus befreite Arbeit erwarten können. Das setzt nicht nur guten Willen voraus, sondern auch überzeugende Persönlichkeiten, deren Kompetenz ihnen genügend Autorität und Durchsetzungsvermögen auch gegen Parteiapparate, Bürokratie und Lobbys verleihen. Die neue Bildungsministerin war bisher erfolgreiche Rektorin einer Universität und Chefin der Rektorenkonferenz. Sie ist ohne Zweifel besonders qualifiziert, die längst fälligen echten Reformen am Bildungssystem in Gang zu bringen. Bildung ist die wichtigste Investition in die Zukunft des Landes. Im Bildungsressort ist am meisten aufzuholen. Aber die Universitäten und die Forschung bekommt sie nicht. Die bleiben beim Vizekanzler, Wirtschaftsminister und Parteiobmann. Man weigert sich zu glauben, dass diese Chance auf ein durchgängiges Bildungskonzept nicht wahrgenommen werden konnte, weil die Partei des Vizekanzlers dies als Handstreich gegen ihren Besitzstand aufgefasst hätte. Wo bleibt da „I will“?

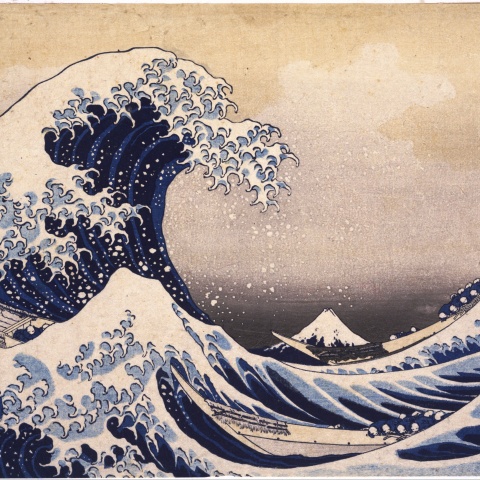











Kommentare