
„Alle Kunst ist ganz zwecklos – gerade das macht sie so wertvoll“
Der Kultur wird nachgesagt, sie koste nur. Doch ihre Effekte aus der Umwegrentabilität und ihre Bedeutung für die Gesamtgesellschaft sind enorm. Die kulturelle Infrastruktur gewinnt als wirtschaftlicher Standortfaktor immer mehr an Bedeutung.
Die öffentliche Förderung von Kultureinrichtungen wird bisweilen auf ihren Kostencharakter reduziert. Doch die Kultur ist in der Lage, mehr zurückzugeben als die bloßen Erkenntnisse aus einer geistigen Auseinandersetzung mit ihr. Sie straft diejenigen Lügen, die von ihr abschätzig als bloßem Subventionsempfänger reden. Kultur spielt als Wirtschaftsfaktor und identitätsstiftendes Merkmal einer Region eine immer stärkere Rolle. Dabei umfasst Kultur nicht nur die klassischen Sparten künstlerischen Ausdrucks, sondern das gesamte kreative Potenzial einer Gesellschaft. Abseits aller begrifflichen Schwierigkeiten einer Kultur-Definition wird für Vorarlberg schnell klar, dass Kultur viele Funktionen auf individueller, auf gesamtgesellschaftlicher und auch auf wirtschaftlicher Ebene wahrnimmt. „Das kulturelle Angebot trägt zur Attraktivität der Region bei und ist als sogenannter weicher Standortfaktor bedeutend für die regionale Entwicklung“, sagt Christoph Thoma, selbst Musiker und Marketingmanager in Bregenz.
„In Regionen wie Vorarlberg, in denen die Betriebe einen Zuzug an sogenannten High Potentials benötigen, erhöht ein gutes Kulturangebot die Wahrscheinlichkeit, auf einen hohen Anteil qualifizierter Arbeitnehmer zu stoßen bzw. diese akquirieren zu können“, verweist Montforthaus-Geschäftsführer Edgar Eller auf die Dynamik kulturell attraktiver Regionen. Dieser Faktor wird vor dem Hintergrund des sich künftig noch weiter verschärfenden Fachkräftemangels weiter an Bedeutung gewinnen.
Beispiel Bregenzer Festspiele
Nimmt man die Bregenzer Festspiele als Beispiel, wird schnell klar, was gemeint ist, denn sie produzieren nicht nur Kunst auf höchstem Niveau, sie funktionieren auch als Wirtschaftsmotor: Die Tätigkeit des Festivals bringt Österreich und der Region einen gesamtwirtschaftlichen Mehrumsatz von bis zu 170 Millionen Euro pro Jahr. Vor allem die regionale Tourismuswirtschaft und heimische Wirtschaftsbetriebe profitieren erheblich von dem Kulturunternehmen. Es werden direkte Steuerflüsse von rund 20 Millionen Euro pro Jahr in Gang gesetzt. Auf diesem Weg wird der öffentlichen Hand mehr zurückgegeben, als an Subventionen ausgeschüttet wird. Aber nicht nur ein beachtlicher Mehrumsatz, auch eine beeindruckende Zahl von Arbeitsplätzen entstehen durch das Sommerfestival: Laut einer etwas älteren Studie des IHS sind die Bregenzer Festspiele ein Garant für über 1000 Vollzeitarbeitsplätze außerhalb des Festspielhauses. Die genaue Zahl dürfte heute noch merklich darüber liegen. Von den Aufbauarbeiten zur kommenden Produktion auf dem See, „Turandot“, profitierten rund 40 Technikunternehmen, davon 25 aus Vorarlberg. Festspiel-Pressesprecher Axel Renner: „Das Festival ist mit bis zu 80 Prozent finanzieller Eigendeckung der Branchen-Spitzenreiter. Darüber hinaus sorgt das Unternehmen für zwei der heutzutage wertvollsten Güter: Aufmerksamkeit und Bekanntheitsgrad.“
Regionale und lokale Wertschöpfungseffekte ergeben sich besonders auch durch Bauvorhaben wie im Fall des im Jänner dieses Jahres neu eröffneten Montforthauses Feldkirch: Über 44 Millionen Euro betrugen die Baukosten, rund 80 Prozent der Bauvergaben gingen an heimische, sprich Vorarlberger Unternehmen. In Bregenz wird gerade an einer Wirkungsanalyse gearbeitet. Untersucht werden sollen die ökonomische Effekte, die sich aus den direkten, indirekten und (konsum-)induzierten Effekten des Wirkens der Kulturinstitutionen zusammensetzen. Zusätzlich im Mittelpunkt der Betrachtung stehen die Wertschöpfungseffekte durch Hotellerie, Gastronomie, Handel oder öffentlichen Verkehr, die Effekte aus Kaufkraft und Beschäftigung und vor allem die Fiskaleffekte.
Spillover-Effekte im Tourismus
Vorarlberg positioniert sich schon seit Längerem als kulturell geprägtes Tourismusland im alpinen Raum, als anregende Verbindung von Natur & Kultur im Alpenraum. Mit dieser Ausrichtung zielt Vorarlberg auf reisefreudige Menschen aus höheren Bildungs- und Einkommensschichten in den wichtigsten Herkunftsmärkten. „Diese avisierte Gästegruppe ist nicht nur grundsätzlich gegenüber kulturellen Angeboten offen, sondern erwartet sich auch kulturelle Kompetenzen im Urlaubsland. Das heißt, kulturelle Kompetenzen sind eine notwendige Bedingung dafür, als Reiseziel für dieses Milieu auch attraktiv zu sein“, erklärt Brigitte Plemel, bei Vorarlberg Tourismus unter anderem zuständig für Marktforschung. Dies führte unter anderem zur Gründung der Plattform „Kultur und Tourismus“: Die 2008 von der Kulturabteilung des Landes und von Vorarlberg Tourismus gemeinsam initiierte Plattform, die mehr als 200 Vertreter aus Kultur und Tourismus involviert, soll die Vernetzung und das gegenseitige Verständnis fördern.
„Für 27 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung in Deutschland, dem wichtigsten Herkunftsmarkt für den Vorarlberger Tourismus, ist ‚etwas für Kultur und Bildung tun‘ ein besonders wichtiges Urlaubsmotiv“, sagt Plemel. Laut T-MONA-Studie für Vorarlberg aus dem Jahr 2014 besuchten 32 Prozent der Sommergäste Sehenswürdigkeiten, sechs Prozent Festivals und Events, neun Prozent Ausstellungen und Museen, sechs Prozent Konzerte mit klassischer Musik und 13 Prozent Veranstaltungen zu Volkskunst und Brauchtum.
Kulturland Vorarlberg
Vorarlberg gehört, gemessen an seiner Einwohnerzahl, nicht nur zu den wirtschaftlich attraktivsten Regionen, sondern auch zu den kulturellen Hotspots Europas. Kulturelle Angebote eröffnen ein weites Feld: Sie beziehen Künstler, Designer, Musiker, Entertainer, Architekten und Autoren, aber auch hochwertige Gastronomie, Werbefachleute, Berater, Coaches und Therapeuten mit ein. Kultur, Kreativität und wirtschaftliches Wachstum gehen Hand in Hand. Dies trifft insbesondere für die Bodenseeregion zu. „Eine breite Basis an Kulturinitiativen, gepaart mit international beachteten Leuchttürmen, garantieren eine unglaubliche Dichte. Dennoch gilt es, das eigene kulturelle Selbstverständnis auch kritisch zu hinterfragen. Der Kulturmanager Ullrich Fuchs sprach bei der Kulturenquete des Landes von einer ‚Selbstgenügsamkeit‘ in Vorarlberg. Man ist schnell zufrieden mit dem selbst Erreichten“, warnt Eller.
Zwecklose Kunst
Bei aller ökonomischen Relevanz sollte nicht vergessen werden: Kulturelle Hervorbringungen und Artefakte stellen nicht zuletzt auch immaterielle Werte und Leistungen dar – jenseits der auf direkte Nutzbarmachung bezogenen Perspektiven. Zudem hat Kultur auch einen Bildungscharakter und damit eine gesamtgesellschaftliche Bedeutung. Letztendlich dürfe man nicht der Versuchung erliegen, der Kunst und Kultur Fesseln ökonomischen Zweckdeckens anlegen zu wollen. Thoma: „Kunst braucht öffentliches Geld, Kunst braucht Freiraum, um kreative Ideen entstehen zu lassen, die auch die Basis für die Weiterentwicklung der Gesellschaft darstellen. Daher ist jeder Cent in Kunst und Kultur eine Investition in den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Aber auch hier gilt: Die Menschen sollten wissen, was wäre, wenn es kein Kulturangebot mehr gäbe.“ Auch für Edgar Eller haben Kunst und Kultur zu guter Letzt ihren Selbstzweck abseits des Messbaren: „Wer den Wert von Kunst und Kultur an ihrer Wertschöpfung misst, begeht das, was man als klassischen Kategorienfehler bezeichnet.“








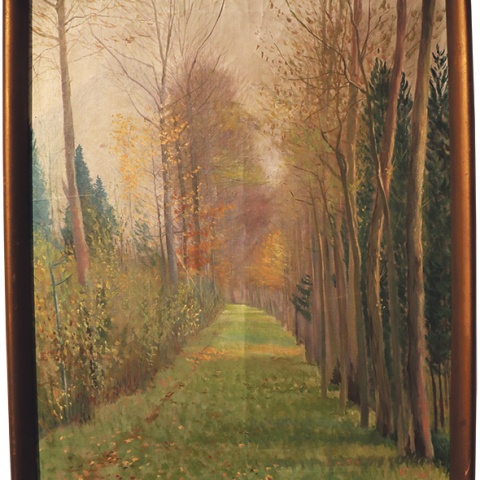




Kommentare