
Wie weiter? Ausblick auf 2016
Der Ausblick auf das Jahr 2016 wird von den Geschehnissen der letzten Monate überschattet. Wer nicht schon von den hartnäckigen wirtschaftlichen und politischen Schwierigkeiten verunsichert war, dessen Weltsicht wurde von den Hunderttausenden zerstört, die aus dem Nahen Osten und aus Afrika nach Europa aufgebrochen sind. Endlose Flüchtlingskarawanen, die hier Aufnahme begehren, lösten Mitgefühl und Hilfsbereitschaft aus, aber auch Entsetzen, Ratlosigkeit und Zukunftsängste. Und bange Fragen: Wie viele noch? Wohin? Was bedeutet das für unsere Zukunft? Antworten sind heute noch sehr ungewiss. Aber auch, wer wie Frau Merkel – „wir schaffen das“ – diese Herausforderung positiv aufnehmen wollte, wurde von den schrecklichen Attentaten und der permanenten Bedrohung durch den Dschihadismus zutiefst erschüttert.
Unter solchen Umständen kommen, unabhängig von rein wirtschaftlichen Überlegungen, keine optimistischen Prognosen zustande. Die Bewältigung der Sicherheitskrise beansprucht die Regierungen und lenkt sie davon ab, konstruktive Ansätze für die Überwindung der Probleme zu verfolgen. Es ist wohl unvermeidlich, dass ihre Aufmerksamkeit eine pessimistische Schlagseite hat und nicht damit rechnet, dass die Krise auch positive Energien auslösen könnte: Es wäre ja vorstellbar, dass der Bürgerkrieg in Syrien durch politische Zusammenarbeit beendet wird, dass das Verhältnis zwischen Europa, den Vereinigten Staaten und Russland durch den gemeinsamen Feind verbessert wird, dass Brutstätten des Terrors entwaffnet und die Ursachen an der Wurzel bekämpft werden, dass unter dem Angriff die in der Finanzkrise beschädigte europäische Zusammenarbeit gestärkt wird, dass sich unter solchen Umständen Großbritannien nicht von Europa lossagt, aber die Konstruktion Europas zu verbessern hilft. Und dass die Politik auch die Chancen der Immigration nutzt, knapp werdende Qualifikationen aufzufüllen.
Aber ehrlich gesagt: Sehr überzeugend sind diese Argumente nicht. In Afghanistan herrscht Krieg bereits seit 40 Jahren, der israelisch-palästinensische Konflikt reicht sogar nahezu 70 Jahre zurück. Im Nahen Osten, in Nordafrika und südlich der Sahara träumen noch Millionen von einem Leben in Europa. Deren Situation muss dort verbessert werden. Das erfordert Aufwand an Geld und Organisation, auf den die Bevölkerung eines wirtschaftlich stagnierenden Europas nicht vorbereitet ist. Für sie zeichnen sich ohnehin auch sonstige Mehrbelastungen ab: Schuldenabbau, Kosten der Alterung und der Klimapolitik und nun noch ein vermehrtes Sicherheitsbedürfnis.
Seit dem Osterspaziergang in Goethes Faust vor 200 Jahren hatte sich die Sicht der meisten Europäer auf ferne Probleme anderer Kontinente wenig verändert: Sie fühlten sich nicht davon berührt, „wenn hinten, weit, in der Türkei, die Völker aufeinander schlagen“. Heute ist die Realität eine andere. Hunderttausende Männer, Frauen, Kinder, ganze Familien sind mit schlechtem Schuhwerk und durchnässter Kleidung in endlosen Karawanen aufgebrochen, ihre Zukunft in Europa zu finden. Sie sind nicht mehr „weit hinten“. Sie sind da.
Trotz der Bilder, die unter die Haut gehen, ist das Problem auf kurze Sicht noch überschaubar. Deutschland rechnet 2015 mit etwa 900.000 Asylanträgen, von denen die Hälfte genehmigt werden dürfte. Das würde einen Mehraufwand des Staates von einem halben Prozent des BIP für jedes der kommenden Jahre erfordern. Allerdings kommen laufend mehr Flüchtlinge hinzu. Österreich hat für die vielleicht 50.000, denen schließlich Asyl gewährt wird, mit einem Aufwand von einer Milliarde Euro, das sind 0,3 Prozent des BIP zu rechnen – ohne die Kosten für 2016 neu hinzukommende Flüchtlinge, für Rücktransporte und ohne Nebenkosten, die über die Grundversorgung hinausgehen. Die Länder mit so starker Einwanderung sind gut beraten, nicht den Minimalaufwand für die Integration der neuen Bevölkerungsgruppen einzuplanen. Sie riskieren sonst Zustände wie in den Außenbezirken von Paris: hoffnungslose und fanatisierte Jugend, Hass und Verbitterung.
Der Ausblick auf 2016 wird nicht nur von Flüchtlingen und von Kriegen geprägt, sondern auch von anhaltenden Schwächezeichen der Weltwirtschaft: massiver Wirtschaftsrückschlag in China, schwere Rezessionen in Russland und Brasilien. Von der Dynamik der BRIC-Staaten ist keine Rede mehr. „Weltweite Erholung wird nur langsam an Kraft gewinnen“ schreibt die OECD in der Prognose vom 9. November; Betonung auf: „nur langsam“. Das ist nicht neu, das traf auf fast jedes Jahr seit 2009 zu, gefolgt von enttäuschten Hoffnungen und einer Revision der Wirtschaftsdaten nach unten im folgenden Jahr.
Auch die Aussichten für Europa wurden gerade wieder, wenngleich mäßig, zurückgenommen. Aber immerhin wird für Deutschland und für die Eurozone eine zaghafte Beschleunigung des BIP-Wachstums von 1,5 Prozent (2015) auf 1,8 Prozent (2016) angenommen und eine Fortsetzung ins Jahr 2017 hinein. Österreich erreicht in beiden Jahren abermals nicht den Durchschnitt der Eurozone. Wehklagen darüber hilft nicht weiter, sondern nur, das Gemeinsame über trennende Eigeninteressen zu stellen, und zupackende Initiative.
Was die Prognosezahlen wert sind, haben uns die vergangenen Jahre gezeigt. Gegen einen durchgreifenden Aufschwung sprechen mehrere noch immer wirksame Faktoren: ausgeprägte Investitionszurückhaltung, Einsparungsbedarf der meisten Staatshaushalte, nicht zuletzt wegen der Tilgung der Staatsschulden und des alterungsbedingt steigenden Sozialaufwands und wegen des allgemeinen Vertrauensverlusts in die Politik, besonders auch in die EU. Jedenfalls muss sich Europa fundamentalen Veränderungen der Welt und ihrer Mechanismen stellen. Politische Unsicherheit umgibt im Wahljahr aber auch die Führungsrolle der Vereinigten Staaten. Japan findet seit zweieinhalb Jahrzehnten aus der Krise nicht heraus. Die Hoffnung, dass es bald weiter geht wie früher einmal, ist eine Illusion.
In einer solchen Umgebung wäre die österreichische Politik, der es in den letzten Jahren an Einigkeit und Einsicht fehlte, gut beraten, den Veränderungen der Welt und der Lebensbedingungen nicht mit überholten Positionen und Ideologien zu begegnen. Da müssen, besonders im Bildungswesen, endlich alte Zöpfe abgeschnitten werden. Unsere Jugend ist dabei, neue Formen der Arbeit, der Gemeinschaft und der Lebensinhalte zu erproben, neue Technologien und ihre Möglichkeiten innovativ weiterzuentwickeln. Ihre Neugier, ihre Bereitschaft zu Initiative, ihre Phantasie, auch ihre Kritik müssen ermutigt werden. Die Politik muss ihr den Raum schaffen, den sie dazu braucht.

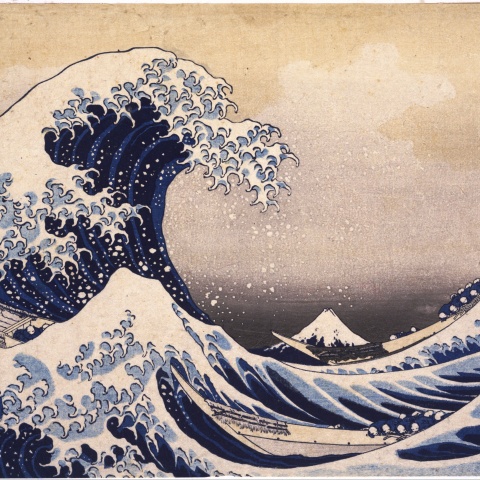











Kommentare