
Stadtfüchse
Der Mensch neigt zu scharfen Trennungen: Wildtiere haben gefälligst in der Wildnis zu wohnen. Die Stadt ist den Haustieren vorbehalten, allenfalls noch den Singvögeln und in den Parks den Eichkätzchen. Stadttauben sind keineswegs beliebt, müssen aber wohl oder übel geduldet werden. Doch größere Säugetiere haben hier nichts verloren. Überflüssig zu erwähnen, dass sich die Tiere nicht an diese vom Menschen definierten Revierzuweisungen halten. Manch Autofahrer kann ein Lied davon singen, wenn wieder einmal ein Marder Kabel und Lenkmanschetten angeknabbert hat. Dachse durchwühlen auf der Suche nach Engerlingen Rasen und Gärten weitaus effizienter, als ein Igel dies jemals könnte. Und auch Füchse haben längst den Siedlungsraum als ihr neues Zuhause erkoren. Fuchs und Hase sagen sich nicht mehr an entlegenen Orten „Gute Nacht“.
Der Rotfuchs (Vulpes vulpes) ist das am weitesten verbreitete, wildlebende hundeartige Raubtier. Von Gegenden nördlich des Polarkreises bis in die Tropen, in Eurasien, Nordamerika und Nordafrika kann man ihn antreffen. In Australien wurde er Mitte des 19. Jahrhunderts ausgesetzt. Die vom Mensch aufgestellte Systematik verweist ihn in die Ordnung der Carnivora, der Fleischfresser. Im Lied wird er als Gänsedieb besungen, und nicht selten fallen ihm Hühner auf einem Bauernhof zum Opfer. Doch er hält nichts von solchen Zuweisungen und ist auch pflanzlicher Kost durchaus nicht abgeneigt. Er ist ein Allesfresser, ein Opportunist und Generalist: Der Fuchs frisst alles, was er leicht erbeuten kann und was ihm reichlich Energie liefert. Da drängen sich menschliche Siedlungen als neuer Lebensraum geradezu auf. Mäuse, Ratten und Tauben sind hier weitaus zahlreicher und leichter zu erbeuten als in der „freien Natur“. In Mülltonnen und auf Komposthaufen findet er sein „All-you-can-eat-Buffet“, Fallobst und Beeren gibt es in den Gärten zuhauf, und Nahrungskonkurrenten sind rar. Auch an Versteckmöglichkeiten mangelt es nicht. Und die Städte bieten Wärme: Im Zentrum von Wien liegen die Temperaturen oft vier bis sechs Grad höher als in der Peripherie – ein unschätzbarer Vorteil im Winter. Und noch eines hat der Fuchs gelernt: In der Stadt fehlen diese komischen Zweibeiner mit ihren Donnerbüchsen, die ihm draußen in Wald und Feld das Leben schwermachen. Er hat gelernt, sich mit den Menschen zu arrangieren, hat einen Teil seiner natürlichen Scheu abgelegt.
Seit den 1930er Jahren kennt man Stadtfüchse aus den Vororten von London. Ab den 1950er Jahren begannen sie, Berlin zu erobern, und ab den 1990er Jahren entdeckten sie mehrere Schweizer Städte als neuen Lebensraum. Wie viele Füchse in unseren Städten leben, lässt sich platterdings nicht beantworten. Für Zürich nennt eine grobe Schätzung rund 1200 Tiere, und in Berlin sollen es gar mehrere Tausend sein. Die Haltung der Menschen zu ihren neuen Mitbewohnern ist unterschiedlich: Manche heißen den Fuchs in romantischer Verklärung als ein Stück „ursprünglicher Wildnis“ im Asphaltdschungel willkommen, halten aber eine vernünftige Distanz. Andere füttern ihn gegen alle Vernunft, sei es, um die Tiere besser beobachten zu können, sei es aus unbegründetem Mitleid mit den vermeintlich hilfsbedürftigen Kreaturen „fernab ihrer Heimat“. Bei einer dritten Gruppe stehen Skepsis und Angst im Vordergrund: Fuchsbandwurm und Tollwut sind die Schlagworte, die durch die Boulevard-Presse geistern, und Haustierhalter befürchten Angriffe auf ihre Lieblinge. Trotz aller Vorbehalte überwiegt eine positive Haltung. In Großbritannien gaben 65,7 Prozent der Befragten an, Stadtfüchse zu mögen, weitere 25,8 Prozent betrachteten sie neutral. Und in einem Münchner Vorort bestätigten gar 91 Prozent, Stadtfüchse hätten ein Recht auf Leben. Sind aber die nachbarschaftlichen Beziehungen gestört, so werden Rufe nach drastischen Lösungen laut: Der Fuchs muss weg. Dabei wird ganz übersehen, dass Füchse territoriale Tiere sind. Wird ein Territorium durch Abschuss frei, so bemerkt dies sicherlich ein Jungfuchs, der sich gerade sein eigenes Revier abstecken will.
Für die Forschung drängte sich eine neue Fragestellung auf: Können die Populationen von Stadt- und Landfüchsen anhand ihres genetischen Materials unterschieden werden? Um dies zu beantworten, wurden Proben von mehr als 370 Rotfüchsen aus Berlin und Umland analysiert. Der genetische Code offenbarte zwei unterschiedliche Populationen, die sich weitgehend mit den Gebieten des städtischen Ballungsraums und des angrenzenden ländlichen Raums deckten. Dass Gewässer und andere landschaftliche Barrieren den genetischen Austausch zwischen zwei Populationen begrenzen, wurde schon seit längerer Zeit vermutet. In Berlin konnte dies verifiziert werden, doch die genetischen Unterschiede waren zu groß, um allein damit erklärt werden zu können. Als Schlüsselfaktor erwies sich die Grenze zwischen städtischen und ländlichen Gebieten. Auch wenn es hier nur wenige physische Barrieren gibt, steigen am Stadtrand die Zahl der Menschen und die Dichte des Hausbestandes sprunghaft an. Stadtfüchse sind menschlichen Aktivitäten gegenüber sehr viel toleranter als Landfüchse. Daraus resultiert eine Verhaltensbarriere, die den genetischen Austausch zwischen den beiden Populationen unterbindet.
Offen bleiben muss, ob sich diese Erkenntnisse auf Vorarlberg übertragen lassen. Ist auch die „Rheintalstadt“ Realität, so ist diese doch zu grün, um einem Vergleich mit London, Berlin oder Zürich standzuhalten. Obwohl sich die Grenzen verschieben, so bleiben sie dennoch scharf. Doch in unseren lockeren Siedlungen unterliegen die Füchse keinem derart hohen Anpassungsdruck wie in Großstädten. Dennoch – oder vielleicht gerade deshalb – dürfen wir annehmen, dass sich Füchse auch im Ländle im Umfeld menschlicher Behausungen wohlfühlen.

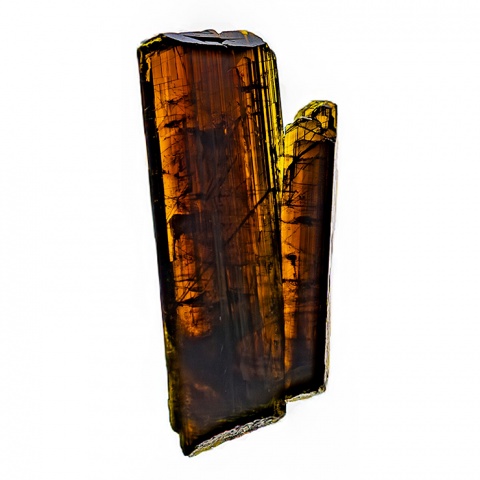









Kommentare