
Wie Ordnung in die Schatzkammer eines jeden (Natur-)Museums kommt
Der Winter steht vor der Tür, und damit diejenige Jahreszeit, in der die Natur zur Ruhe kommt. Pflanzen haben ihre Energiereserven in Wurzeln und Knollen gespeichert, die meisten wirbellosen Tiere haben sich in frostgeschützte Winterquartiere zurückgezogen, sei es als geschlechtsreife Imago, sei es als Larve oder Puppe, oder gar als Ei, das in einem sicheren Versteck abgelegt worden ist. Doch wer meint, dass nun auch im Naturmuseum eine ruhigere Zeit einkehrt, der irrt.
Freilich, die Zahl der Bestimmungsanfragen und Beobachtungsmeldungen, die es in der Datenbank zur Artenvielfalt Vorarlbergs zu dokumentieren gilt, hat deutlich abgenommen. Doch nun langen Berichte und Datenlisten zu den Forschungsprojekten ein, welche die inatura im ablaufenden Jahr unterstützt hat. Auch diese Informationen müssen Aufnahme in die Datenbank finden, natürlich aufbereitet in standardisierter Form nach den Regeln der internationalen Forschergemeinschaft. Und zu manchem Projekt gibt es Belege für die Sammlung des Museums: Einzelexemplare von schwer bestimmbaren oder auf andere Art besonderen Tier- und Pflanzenfunden müssen für eine spätere Überprüfung in der Museumssammlung dauerhaft verwahrt werden – etwa, wenn der Verdacht besteht, dass eine Art auf Basis genetischer Unterschiede in zwei äußerlich kaum zu unterscheidende Zwillingsarten aufgespaltet werden könnte. Und auch das Material für eben solche genetischen Studien muss (internationalen Regeln folgend) in einer Museumssammlung hinterlegt werden. Dass diese Belege in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen entnommen werden, ist Grundvoraussetzung für die Unterstützung eines jeden Forschungsvorhabens.
Bei den meisten Forschungsprojekten ist es unmöglich, gezielt nur eine einzelne Tiergruppe zu besammeln. Um ein repräsentatives Spektrum möglichst aller in einem Gebiet vorkommenden Arten erfassen zu können, ist der Einsatz von Fallen unerlässlich. Dies sind zum Beispiel kleine Becher, die ins Erdreich eingesenkt werden. Krabbeltiere, die den Becherrand nicht erkennen, plumpsen in eine Konservierungsflüssigkeit und können später bestimmt werden. Sie per Sichtung aufzuspüren und von Hand zu fangen, wäre hingegen ein Ding der Unmöglichkeit. Aber diese Fallen arbeiten nicht selektiv. Wer eigentlich nur Spinnen studieren will, muss dennoch damit rechnen, im Becher auch andere Tiergruppen wie Käfer, Asseln, Tausendfüßer und Schnecken zu finden, ja manchmal sogar kleine Mäuse. Natürlich wäre es verantwortungslos, diese Beifänge mit gut dokumentierten Fundumständen einfach zu entsorgen. Doch wohin damit? – Selbstverständlich gelangen auch sie ins Museum!
Damit eine Museumssammlung nicht zu einem kunterbunten Leichenhaufen verkommt, muss jeder Neueingang penibel erfasst werden. An erster Stelle steht das Eingangsbuch, das alle Neuerwerbungen mit Herkunft, aber auch mit aktuellem Standort im Museum verzeichnet. Bei unsortierten Beifängen ist damit die sofort anfallende Arbeit bereits erledigt. Eine Sortierung im Detail und – im Idealfall – die wissenschaftliche Auswertung folgen später. Die aufbereiteten Belege zur eigentlichen Studie aber werden entsprechend ihrer systematischen Stellung in die Sammlung eingegliedert, die zugehörigen Metadaten in der Inventardatenbank registriert. Belege zu Forschungsprojekten mögen zahlreich sein, haben aber gegenüber Einzelobjekten einen entscheidenden Vorteil: Integraler Teil der Ergebnisse jeder Studie ist eine Fundliste, in der die Belege bereits erfasst und entsprechend markiert sind. Nun muss „nur“ noch die Inventarnummer vergeben werden, bevor die Belege mit Sammlungszetteln bestückt werden können. Gleichzeitig gilt es, auch historisches Sammlungsmaterial normgerecht zu erfassen.
Die inatura agiert bei all diesen Inventarisierungsarbeiten nicht als Einzelkämpferin im „luftleeren Raum“. Die Zeiten, in denen ein Museum seine Sammlungen wie ein Zwerg oder ein Drache als Schatz gehütet hat, sind – wenn es sie je gegeben hat – endgültig Vergangenheit. Vernetzung lautet das Gebot des 21. Jahrhunderts. Denn erst wenn Museums- und Universitätssammlungen gemeinsam all ihre Objekte in einem zentralen Portal virtuell zugänglich machen, stehen diese auch einer internationalen Forschergemeinschaft für weiterführende Studien und großräumige Vergleiche zur Verfügung.
In Österreich haben sich daher aktuell 14 Institutionen (von Museen über Universitäten bis hin zu außeruniversitären Forschungseinrichtungen) unter der Dachmarke „OSCA – Open Scientific Collections Austria“ zusammengefunden. Ihr gemeinsames Ziel ist nicht nur die Inventarisierung der (größeren) naturwissenschaftlichen Sammlungen. Zu den Bemühungen um eine gemeinsame Sprache für und Mindestanforderungen an die Metadaten zu den einzelnen Objekten trat bald das Bestreben, wenigstens ausgewählte Stücke auf der Internetplattform osca.science im Bild sichtbar zu machen – vorangetrieben durch das Förderprogramm „Kulturerbe digital“ des Bundesministeriums für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport. Natürlich ist die inatura im OSCA-Konsortium vertreten. Mit Mitteln von „Kulturerbe digital“ hat die inatura begonnen, ihren „geordneten Heuhaufen“, das Blütenpflanzenherbar, im Bild zu dokumentieren. Mit einer eigens dafür angeschafften Kamerastation werden die einzelnen Belege fotografiert. Die mit den Funddaten verknüpften Fotos werden dann an das Portal osca.science sowie von dort an andere Vernetzungsprojekte (Kulturpool, Biodiversitätsatlas etc.) übermittelt, von wo sie weltweit abgerufen werden können. Für die inatura ist OSCA ein weiteres Mittel, sich ihren festen Platz als wissenschaftliche Institution in der österreichischen Forschungslandschaft zu bewahren.

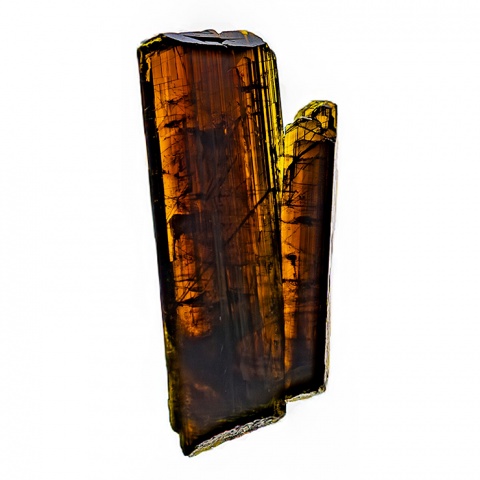









Kommentare