

Grüne Berge – über nachhaltige touristische Vorzeigeprojekte in Vorarlberg
Eine österreichweite Publikation zum Thema Nachhaltigkeit lobt acht „touristische Vorzeigeprojekte aus Vorarlberg“ – etwa den Tempel 74 in Mellau oder den Schubertiade-Konzertbus. Doch was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich? Und warum ist Vorarlberg in dieser Hinsicht eigentlich weit über die Grenzen hinaus bekannt, wie eine Wiener Tageszeitung jüngst berichtete? Von guten Beispielen und frühen Denkanstößen.
Was 1976 als kleine Reihe von Liederabenden und Kammerkonzerten in Hohenems begann, ist heute eines der bedeutendsten Lied- und Kammermusikfestivals der Welt: Die Schubertiade. Sie lockt jährlich rund 35.000 bis 40.000 Besucher nach Schwarzenberg und Hohenems, wobei der größte Teil der Gäste aus dem deutschsprachigen Raum kommt. Allerdings bietet vor allem Schwarzenberg zu wenige Übernachtungsmöglichkeiten, viele Gäste der Schubertiade weichen daher in Unterkünfte in umliegenden Orten aus. An diesem Punkt setzt das Projekt Konzertbus an. Die Besucher werden mit einem eigens eingerichteten und drei Linien umfassenden Busnetz direkt von ihren Hotels und Pensionen zum Veranstaltungsort gebracht, und dort auch wieder abgeholt. Der Transfer ist auf die Konzertzeiten abgestimmt, wobei die Taktung durchaus eine Herausforderung ist. Das Projekt wird gemeinschaftlich finanziert, von der Regio Bregenzerwald, von Bregenzerwald Tourismus sowie von jenen neun Gemeinden, die entlang der Routen liegen. Und dass im Vorjahr über 2100 entsprechende Tickets verkauft worden sind – und damit offenbar auch 40 Prozent der Betriebskosten deckten –, das ist für die Verantwortlichen: „Ein starkes Signal für die Akzeptanz dieser Form von sanfter Mobilität.“
Tradition, Interpretation
Der Tempel 74 in Mellau gilt wiederum als Musterbeispiel für nachhaltige Baukultur und sanften Tourismus. „Entstanden aus der Vision, das kulturelle Erbe und die Bautradition des Bregenzerwaldes mit modernen, nachhaltigen Bauprinzipien zu verbinden“, wurde das 2019 entstandene Projekt seither vielfach ausgezeichnet, unter anderem 2021 mit dem Staatspreis Architektur und dem Vorarlberger Holzbaupreis. Verena Konrad und Sandra Hofmeister dokumentieren in ihrem Buch „Architektur in Vorarlberg“ den Tempel 74 als eines jener „50 herausragenden Projekte“, die im Land in den vergangenen 25 Jahren entstanden sind. Dort heißt es, dass der Tempel mit seinen Appartements zu den attraktivsten Ensembles im Ortsbild gehöre: „Anstelle eines abbruchreifen Bauernhauses wurden zwei Neubauten errichtet, die das harmonische Miteinander der Häusergruppe um den Dorfbrunnen würdigen und zugleich die besonderen, fast urbanen Qualitäten des Weilers in die Gegenwart übersetzen.“ Wobei Haus A ein detailgetreuer Wiederaufbau in handwerklich bäuerlicher Tradition ist, und Haus B „ein Neubau, der die regionale Bautradition in freier Interpretation fortschreibt“. Jürgen und Evi Haller – Jürgen ist der Architekt des Tempels, Evi die Gastgeberin – hätten das rund eintausend Quadratmeter große Baugrundstück übrigens gemeinsam mit Nachbarn gekauft, „um es als Spekulationsgut dem Markt zu entziehen und einen gesichtslosen Wohnbau zu verhindern“.
Stark vertreten
Doch was haben nun der Konzertbus und der Tempel 74 gemeinsam? Sie sind zwei jener touristischen Vorzeigeprojekte, die in der aktuellen Publikation „Nachhaltigkeit in Österreich“ gelistet sind. Wobei Vorarlberg dort insgesamt stark vertreten ist: Acht der insgesamt 48 Projekte stammen aus unserem Bundesland. Präsentiert wurde diese Publikation erst vor kurzem, im Rahmen eines von der Österreich-Werbung organisierten Nachhaltigkeitsgipfels im Festspielhaus in Bregenz. Das Projekt Grüne Spuren, in dessen Rahmen sich Energieverbrauch und CO2-Fußabdruck bei Urlauben an Bauernhöfen transparent erfassen lassen, wird in der Publikation lobend erwähnt, detto die digitale Gästekarte für nachhaltige Mobilität in der Alpenregion Bludenz oder das Modell naturverträglicher Bergsport im Montafon. Weitere in der Nachhaltigkeits-Publikation präsentierte Vorarlberger Projekte sind: PIZ VHOTEL, eine digitale Plattform für verantwortungsvolles Gastgeben und die Rote Wand Friends and Fools, dort ist ein Gourmet-hotel gleichzeitig auch Denkfabrik für nachhaltige Kulinarik. Und schließlich wird auch eine Initiative mit dem Titel Green Mountains lobend erwähnt, werde dort doch Nachhaltigkeit im alpinen Raum neu gedacht (siehe Seite 10).
Nachhaltigkeit sei längst mehr als ein Trend, heißt es im Vorwort der Publikation, „Nachhaltigkeit ist eine Notwendigkeit und eine Chance für die Zukunft des Tourismus.“ Und Österreich hat da durchaus einiges zu bieten. Im Nachhaltigkeits-Reise-Index 2023 liegt die Alpenrepublik in puncto Nachhaltigkeit hinter Schweden und Finnland auf dem dritten Platz – und das bei insgesamt 99 bewerteten Reisedestinationen.
Ein kurzer Exkurs
Nun ist der Ausdruck Nachhaltigkeit im allgemeinen Sprachgebrauch derart abgenutzt, dass an dieser Stelle ein kurzer Exkurs angebracht ist. Was ist Nachhaltigkeit überhaupt? Hans Carl von Carlowitz, ein Oberberghauptmann, verwendet erstmals den Begriff. Der Sachse schreibt 1713 in seinem Buch „Sylvicultura oeconomica“, dass der Anbau von Holz so anzustellen sei, „dass es eine continuierlich beständige und nachhaltende Nutzung gebe / weil es eine unentberliche Sache ist.“ Von Carlowitz stellt sich gegen den auf kurzfristigen Gewinn ausgelegten Raubbau, er fordert einen respektvollen Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen. Doch seine Mahnung gerät in Vergessenheit.
Mit der beginnenden Industrialisierung wird Gewinnmaximierung zum neuen Maßstab. Erst mit der wachsenden Erkenntnis, dass die Ressourcen auf unserer Erde endlich sind, wird Nachhaltigkeit in den 1980er Jahren wieder zu einem Thema, sukzessive, nach und nach. Die UN-Weltkommission für Umwelt und Entwicklung definiert den Begriff 1987 – als „eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.“ Seither haben sich Begriff, Prinzip und Leitbild der Nachhaltigkeit gewandelt.
Drei Dimensionen
Was ursprünglich rein durch ökologische Gesichtspunkte definiert war, versteht sich heute als Konzept mit drei Dimensionen: Ökologie, Ökonomie und Soziales. Auch im Tempel 74 sind diese drei Säulen verankert. Demnach wurde dort der ökologische Fußabdruck reduziert, etwa mit effizienter Dämmung und schadstofffreien Materialien. Durch Zusammenarbeit mit regionalen Handwerkern wurde wiederum die lokale Wertschöpfung gestärkt, auch sensibilisieren Architekturführungen Gäste für nachhaltige Bauweisen. Gastgeberin Evi Haller sagt im Interview (siehe Seite 11), dass richtig verstandene Nachhaltigkeit für sie und ihren Mann kein Trend sei, sondern „Haltung, tiefste Überzeugung und Selbstverständlichkeit“. Es gehe darum, mit Ressourcen sorgsam umzugehen, eben ökologisch, sozial und ökonomisch: „Nur wenn all diese Aspekte zusammenwirken, entsteht ein stimmiges und zukunftsfähiges Projekt.“ Haller sagt auch: „Dem nachhaltigen Tourismus in Vorarlberg und insbesondere im Bregenzerwald gehört ganz klar die Zukunft.“
Es gibt Studien, die das Gesagte belegen. Sie belegen auch, dass Urlauber mittlerweile bereit sind, sich nachhaltiges Urlauben etwas kosten zu lassen. Die Deutsche Presseagentur berichtete 2023, dass 23 Prozent der deutschen Urlaubsgäste in Österreich bereit seien, bis zu 29 Euro mehr pro Nacht für regionale Küche oder bis zu 47 Euro mehr pro Nacht in vollkommen klimaneutralen Hotels zu zahlen. Laut dem Onlinereiseportal booking.com sind gar 50 Prozent der Reisenden bereit, „zumindest ein bisschen mehr für zertifizierte nachhaltige Unterkünfte“ zu bezahlen. Im Tourismus scheint der Trend zur Nachhaltigkeit nicht nur angekommen zu sein, er hat sich, wie Christian Schützinger sagt: „Bereits manifestiert.“ Dem Landestourismus-Direktor zufolge merkt man das in zweifacher Hinsicht: „Zum einen stellt man sich in den touristischen Herkunftsländern verstärkt Fragen in Bezug auf nachhaltiges Reisen und nachhaltige Urlaubsdestinationen. Und zum anderen beschäftigen sich auch Vorarlberger Gastgeber mehr und mehr mit Nachhaltigkeitsthemen, etwa im Umgang mit Lebensmitteln, aber auch in Bezug auf Lieferketten.“ Die Tageszeitung Presse hatte vom Nachhaltigkeitsgipfel in Bregenz berichtet. Dort stand auch, dass es zwar auch in anderen Bundesländern gute Beispiele gebe, aber gerade Vorarlberg in Sachen Nachhaltigkeit „weit über seine Grenzen hinaus bekannt“ sei.
Frühe Denkanstöße
Warum ist das so? Es lohnt sich ein kurzer Blick in die Vergangenheit. Denn bereits vor Jahrzehnten, sagt Schützinger, hatte man sich im Land mit den entsprechenden Themen beschäftigt. Natürlich noch nicht mit dem Klimawandel, aber mit Grund und Boden und mit der Frage, wie weit man in Naturräume überhaupt vordringen dürfe. „Bereits Anfang der 1990er Jahre wurden entsprechende Zuschreibungen, entsprechende Erwartungen an den Tourismus im tourismuspolitischen Leitbild des Landes abgebildet“, berichtet Schützinger – zu einem Zeitpunkt also, an dem es in anderen Ländern – auch in anderen Bundesländern – ausschließlich um den Wettbewerb, den Markt, den Markterfolg gegangen war.
„Fragen der Ressourcenverwendung“, sagt der Geschäftsführer von Vorarlberg Tourismus, „waren bei uns schon früher omnipräsent, man hatte die Entwicklung des Tourismus weit früher als anderswo stets im Zusammenhang mit der Entwicklung des Landes gesehen, ohne dabei aber die betriebswirtschaftlichen Erfolgsfaktoren außer Acht zu lassen.“ So seien touristische Investitionen auf langfristige Perspektiven ausgelegt worden „und nicht auf momentane Geschäftstrends“. Ausbauten in der Hotellerie etwa folgten der Logik ganzjähriger Nutzbarkeit. „Auch das können die Vorarlberger eben sehr gut“, sagt Schützinger: „Unternehmer sein.“ Und weil es im Vorarlberger Tourismus nie darum gegangen sei, um alles in der Welt Absatz zu erzielen, durch Verstellen und durch Triviales, habe das Land über die Jahrzehnte touristischer Entwicklung überaus Wichtiges behalten: Identität. Authentizität. Charakter. Für den Tourismus-Direktor ist das „kulturelle Nachhaltigkeit, die der Einheimische und der Gast gleichermaßen schätzt.“
„Luft nach oben“
Natürlich genügt nicht der gesamte heimische Tourismus – der Schützinger zufolge „15 bis 18 Prozent des regionalen BIP“ erwirtschaftet – den strengen nachhaltigen Kriterien. „Da ist schon noch einiges zu heben“, sagt der Direktor. Beispielsweise in der Mobilität. „Formen der Mobilität sind im Tourismus der wesentliche CO2-Fußabdruck-Treiber, da haben wir als Region, die abseits großer Schienenwege liegt, natürlich Nachteile.“ Dennoch gebe es in diesem Bereich auch positive Entwicklungen. Ihm zufolge hat sich von 2023 auf 2024 der Anteil der Gäste, die mit dem Zug im Sommer anreisen, von sechs auf zehn Prozent erhöht: „Es sind zwar nach wie vor erst zehn Prozent; aber die deutliche Zunahme von einem Jahr auf das andere zeigt, dass es die Bereitschaft gibt, nachhaltig zu handeln und nicht nur darüber zu reden.“ Und all jene, die weiterhin mit dem Auto anreisen, sollten während ihres Aufenthaltes im Land im Idealfall dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad oder gleich schon per pedes unterwegs sein. Ein Beispiel hatte die Presse genauer beschrieben: „Gästetaxen finanzieren in der Region Bodensee den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel und eine unkomplizierte Nutzung für Besucher.“ Nachhaltig entwickelt sich laut Schützinger auch der Bereich der Energiewirtschaft, da gebe es Verbesserungen, „die freilich auch dem wirtschaftlichen Druck geschuldet sind, Energie sparen zu müssen und auch deswegen auf erneuerbare Energieträger umzusteigen“. Auch die Baukultur in Vorarlberg stehe beispielhaft für nachhaltige Entwicklung. Und wo gibt es noch größeren Nachholbedarf? „Im Bereich Lebensmittel und Kulinarik.“
Ob die Reise weiter in Richtung Nachhaltigkeit gehen wird? Der Tourismusforscherin Gabriele Augsbach zufolge ist das Thema in vielen Gesellschaften bereits Teil des gemeinsamen Wertekanons geworden: „Demnach ändern sich auch Reisemotive und -bedürfnisse. Und diese bedeutsame Wandlung der Beweggründe des Reisens nimmt einen immer größer werdenden Einfluss auf die touristische Angebotsentwicklung.“ Augsbach schreibt: „Beherbergungsbetriebe, Verkehrsunternehmen, Destinationen und die Gesamtgesellschaft werden künftig mehr auf Nachhaltigkeit achten, sie strukturiert angehen und systematisch umsetzen. Nicht zuletzt werden Reisende diese Bemühungen würdigen.“
Und welches Fazit zieht der Tourismusdirektor? „Die Mühe lohnt sich. Reisen bildet den Reisenden und den Bereisten. Deswegen muss das Reiseerlebnis so ausgestaltet sein, dass es nachhaltige Wirkungen in beide Richtungen entfalten kann.“ Und da wir alle auch eine Verantwortung unseren Kindern gegenüber hätten, sagt Schützinger, „ist Gegenläufiges mit doppelt wachsamen Augen zu beobachten.“
Die Green Mountains Initiative
Die Silvretta Montafon Gruppe legte mit ihrer Green Mountains Initiative 2022 eine nachhaltige Unternehmensstrategie fest. Als größtes Ski- und Bergsportgebiet im Montafon definiert sie Nachhaltigkeit in den drei Schwerpunktfeldern Klima, Naturraum und Lebensraum und setzt Projekte gemeinsam mit unterstützenden Partnern um.
Im Sinne des Klimaschutzes nutzt die Bahn beispielsweise ausschließlich emissionsfreien Strom und errichtet eigene Photovoltaik-Anlagen – etwa bei der Bergstation der Valisera-Bahn. Die Talstationen, der Silvretta Park und das neue Mitarbeiterhaus werden mit Wärme aus Biomasse beheizt und mit Solarstrom versorgt. Mit Wirkung, wie sich anhand der Treibhausgas-Bilanz 2022/23 zeigt. Mit Aktionen wie „Naturverträglicher Bergsport“ schützt die Silvretta Montafon zudem sensible alpine Lebensräume und fördert Artenschutz. Zur Renaturierung nach dem Winter werden Pistenflächen mit standortgerechtem Saatgut begrünt, Steinmuren beräumt und sensible Zonen ausgewiesen. Die Mitarbeiter engagieren sich regelmäßig bei Projekten für Natur- und Umweltschutz vor Ort. Vorarlbergs erste E-Ladegarage (35 Stationen) im Silvretta Park in St. Gallenkirch und insgesamt rund 70 Ladestellen fördern eine umweltfreundliche An- und Abreise – inklusive Green Ticket Integration für Bahn- und Busbenutzer. Die Infrastrukturplanung respektiert ökologische Grenzen: Erweiterungen von Pisten in Schutzgebieten sind ausgeschlossen. Gemeinsam mit Initiativen und regionalen Netzwerken setzt die Bergbahn Silvretta Montafon auf starke Partnerschaften, um die Green Mountains Initiative umzusetzen. Die Initiative ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie nachhaltiges Handeln in alpinen Regionen sowohl strategisch als auch alltagsnah umgesetzt werden kann. Daniela Vonbun-Häusle





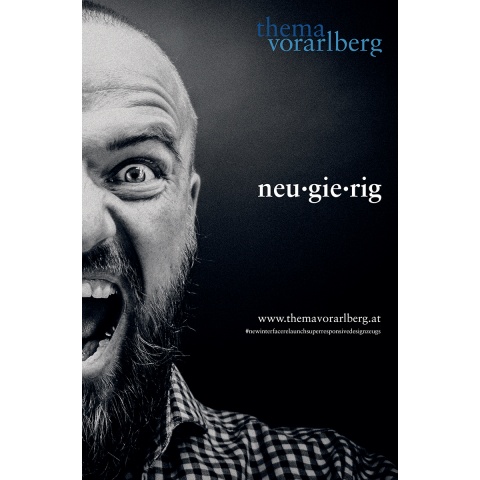








Kommentare