
„So stark war die Polarisierung noch nie“
Gerald A. Matt traf Hannelore Veit (68), eine der profiliertesten und bekanntesten österreichischen Journalistinnen und ehemalige Fernsehmoderatorin, zum Gespräch. Sie war für über 30 Jahre beim ORF tätig, moderierte die ZIB 1 und gilt als USA-Expertin, war sie doch von 2013 bis 2020 Büroleiterin des Korrespondentenbüros des ORF in Washington. Letztes Jahr veröffentlichte sie „Wer hat Angst vor Donald Trump?“
Muss man Angst vor Donald Trump haben?
Heute würde ich mein Buch nennen: „Wer hat keine Angst vor Donald Trump.“ Die ganze Welt hat Angst vor Donald Trump und buhlt gleichzeitig um seine Gunst. Angst ist aber ein schlechter Ratgeber, mehr Selbstbewusstsein wäre angebracht.
Hier wird das meist so dargestellt, es seien die, wie Clinton sie genannt hat, „deplorables“, die zu kurz Gekommenen und Hinterwäldler, ohne Job oder mit der Angst, ihn zu verlieren, die Trump-Wähler und Unterstützer.
Das stimmt nur zum Teil. Da komme ich nicht auf 77 Millionen – das ist mehr als die Hälfte der Amerikaner und Amerikanerinnen, die ihn gewählt haben. Als ich aus Washington zurückgekommen bin, haben mich viele Leute gefragt: Wie kann es sein, dass Trump schon wieder da ist? Sind die Amerikaner alle verrückt? Doch das ist nicht die Innensicht der Amerikaner. Über die Kernwählerbasis hinaus – 30 Prozent plus/minus – gibt es auch sehr viele gescheite und sehr intelligente Leute, die zu Donald Trump stehen.
Dazu gehören auch viele christliche Wähler, obwohl Trump bei Gott kein ausgewiesener Tugendbold ist.
Sie wählen und unterstützen ihn trotzdem, denn er steht für ihr Weltbild. Ich habe sehr viele Trump-Wähler und -Wählerinnen, auch tiefreligiöse Menschen, gefragt: Wie passt denn das zusammen? Die Antwort war immer: Man kann sich im Leben stets zum Besseren wenden. Auch wir sind alle Sünder. Er verteidigt ihr Weltbild gegen die liberale, zu liberale Welt draußen.
Was macht die Faszination Trumps für seine Wähler aus? Was macht ihn so anders?
Er hat es sehr geschickt verstanden, sich selbst als Außenseiter zu verkaufen – als einer, der nichts zu tun hat mit Korruption und politischen Intrigen. Für viele Leute in den kleineren, ländlichen Bundesstaaten ist Washington ein Politsumpf. Und da kommt Trump – in ihren Augen ein erfolgreicher Selfmade-Man und Dealmaker, einer, dem die Menschen abnehmen, von Wirtschaft etwas zu verstehen, einer, der ihre Verachtung für Political Correctness teilt und völlig anders scheint als all die Berufspolitiker mit ihren oft feigen Floskeln. Und Trump kann wirklich witzig sein und auch über sich selbst lachen. Er ist frech und provoziert und gibt denen, die sich an den Rand gedrängt fühlen, eine Stimme. Dass er und seine Unternehmen gar nicht exzellent performt haben, interessiert dabei niemanden. Nicht zuletzt verkörpert er aber den amerikanischen Traum von Freiheit, Aufstieg und Unabhängigkeit.
Für Europäer wirkt er ja oft einfältig, zumindest aber erratisch und rücksichtslos – einer, der nach Laune und Stimmungslage seine Meinung ändert, etwa wenn man sich die Zollpolitik anschaut. Rauf, runter – je nachdem, mit wem er redet. Gibt es auch eine Kontinuität, einen Kern seiner Politik? Hat er vielleicht sogar eine Vision für Amerika?
Ja, eine Vision, die sehr retro ist – das Comeback eines heilen und mächtigen Amerika der Nachkriegszeit, das es einfach nicht mehr gibt. Aber naiv ist er nicht. Sein Hin und Her zwischen Positionen ist ja Basis seiner Deals. Er kommt mit Maximalforderungen, und dann folgt ein Deal, ein Kompromiss, der zumindest für die USA oder für ihn gut sein muss. Er sticht ja auch bei vielem in Wunden hinein, die es tatsächlich gibt – Dinge, die im Argen liegen, die sehr vielen Amerikanern gegen den Strich gehen, ob das die zunehmende Bürokratie ist oder die illegale Migration bis hin zum militärischen Engagement im Ausland. Und Amerikaner sind anders gepolt, haben ein völlig anderes Mindset, lehnen Regulierungen und Eingriffe ins Privatleben zutiefst ab. Mit seinem Programm der Deregulierung, weniger Steuern, weniger Staat und Zerschlagung der Washingtoner Bürokratie erobert er amerikanische Herzen und lenkt von seinen autoritären, antidemokratischen Tendenzen ab.
Clinton hat damals ja die Wirtschaft in den Mittelpunkt seiner Politik gestellt – mit dem Slogan „It’s the economy, stupid“. Ist es heute „It’s migration, stupid“?
Nein, es gilt noch immer „It’s the economy, stupid“, auch wenn Trump die Migration zu seinem Kernthema machte. Das Gefühl, wirtschaftlich abgehängt zu werden, und eine arm machende Inflation war für seine Wahl sicher entscheidender als das Migrationsproblem. Aber klar – Migration hat er voll ausgenutzt, hat das auch in Verbindung gebracht mit Kriminalität, quasi: Einwanderer sind Kriminelle. Dass es eine Krise an der Grenze, einen Kontrollverlust gibt – das haben die Demokraten auch gesagt, aber viel zu spät angefangen, restriktivere Gesetze zu erlassen.
Wobei die US-Migrationskrise ja andere Voraussetzungen und Folgen hat als die europäische.
Ja, es kommen vor allem Latinos aus lateinamerikanischen Ländern, in denen die Wirtschaft am Boden liegt und die Sicherheit durch viele Bandenkriege bedroht ist. Gleichzeitig sehen viele Flüchtlinge Amerika immer noch als das Land der Träume, in dem sie glauben, reich zu werden. Ich habe in Washington, D.C., gelebt. Viele haben dort einen Garten. Und alle Hilfsarbeiten werden von Migranten, von Latinos gemacht. Ein großer Teil der Wirtschaft ist von Migration abhängig, auch wenn Donald Trump das gerne anders hätte. Darüber hinaus: Es gibt den Sozialstaat, wie wir ihn in Europa haben, nicht.
Welche Rolle spielt die Gesellschaftspolitik für den Wahlsieg von Trump? Haben die Leute Wokeness, Identitätspolitik, die Betonung und Bevorzugung von Minderheiten sattgehabt?
Auf jeden Fall. Klar, es gibt die Ostküste, die Westküste, die großen Städte, die demokratisch sind und hier sehr sensibel sind. Aber die Bundesstaaten dazwischen, das ländliche Amerika, ist im Rot der Republikaner gefärbt. Das sind die dünn besiedelten Bundesstaaten. Ich habe mit vielen dort gesprochen, auch mit Frauen, die all diese Debatten und Vorschriften ablehnen. Es herrscht völliges Unverständnis. Da prallen wirklich zwei Welten aufeinander.
Wie sehen Sie diese Polarisierung? Kann man das schon vergleichen mit der Polarisierung, wie wir sie in der Zwischenkriegszeit zwischen Sozialdemokraten und Christlichsozialen, die in den Bürgerkrieg führte? Reden die Leute noch miteinander?
Nein, sie reden eigentlich nicht miteinander. Ich kenne Familien, die Thanksgiving, das große Familienfest, nur mehr gemeinsam feiern können, wenn sie die Politik völlig ausklammern. So stark war die Polarisierung noch nie. Seit Donald Trump ist es wirklich auseinandergegangen – da gibt es nur mehr Pro und Contra Trump, auch in den Medien. Gleichzeitig bestimmt Trump die Debatten, die Demokraten hinken nur mehr hinterher.
Wie sehen Sie die Situation nach der Ermordung von Charlie Kirk – eine weitere gefährliche Eskalation von Polarisierung und Gewalt? Was wird das tödliche Attentat auslösen?
Gewalt hat es in der Politik in den USA immer gegeben – denken wir daran, dass mehrere Präsidenten ermordet wurden, dass Ronald Reagan und auch Donald Trump nur knapp einem Attentat entgingen. Ich kann nur hoffen, dass diese Gewalt nicht Normalität wird. Ich fürchte aber, die Ermordung von Charlie Kirk wird die Polarisierung noch weiter verschärfen, die Öffentlichkeit noch mehr emotionalisieren. Trump-Unterstützer sehen Charlie Kirk als Märtyrer, sein Tod wird politisch ausgeschlachtet. Die andere Seite wirft genau das den Republikanern vor.
Sie haben ja in den USA auch studiert und viele Jahre im Land gearbeitet. Wenn Sie in die Anfangsjahre zurückschauen und es mit den heutigen USA vergleichen – was hat sich also abseits dieser Polarisierung noch für Sie verändert?
Extrem viel. Damals war es eine wirkliche Willkommenskultur: Studenten aus Übersee – wir zeigen euch, wie toll wir sind, was für eine tolle Demokratie wir sind, was für ein offenes Land. Das hat sich schon mit dem 11. September schlagartig geändert. Und jetzt noch mehr mit Donald Trump. Jetzt ist einfach alles, was von außen kommt, suspekt. Trumps Narrativ „Die ganze Welt hat uns über den Tisch gezogen“ greift. America First.
Die MAGA-Bewegung ist einer der Katalysatoren des immer schon latent vorhandenen Isolationismus. Braucht Amerika Europa überhaupt? Ist eigentlich jetzt Asien viel wichtiger geworden – und China auch als Konkurrent? Wie sieht man Europa?
Immer mehr wie Trump es sieht – nämlich so, dass Europa mit den USA als Schutzmacht gut gelebt hat und den USA enorm viel verdankt. Die Außenpolitik ist zunehmend Richtung Asien, Richtung Pazifik ausgerichtet – das war schon so unter Obama. China ist der große Rivale. Da geht es um die Weltherrschaft. Ich würde auch sagen, der Ukraine-Krieg ist den Amerikanern lästig, er stört, ist dazwischengekommen – ihre Priorität ist Asien.
Wie sehen Sie da die Position von Trump?
Bis heute unklar. Andererseits denke ich mir: Dieser Krieg geht so furchtbar lange, und nichts hat sich getan – nur Gerede. Wenn einmal einer kommt und versucht, etwas zu tun, dann finde ich das durchaus positiv. Ob allerdings zwei wirklich Ego- und Machtmenschen wie Putin und Trump zusammenkommen, lässt sich nach den bisherigen Erfahrungen mehr als bezweifeln.
Aber würde er das Ende der Ukraine als souveräner Staat, das eigentliche Ziel Putins, hinnehmen?
Ich glaube, in seinem Kopf ist eher: Wir teilen die Ukraine auf. Die Amerikaner haben ja jetzt schon mit den Rohstoffdeals, die sie gemacht haben, ihren Claim quasi abgesteckt. Aber auch da ist Trump – was seine letzten Aussagen angeht – unberechenbar.
Was war Ihr wichtigstes, interessantestes Interview beziehungsweise Gespräch in der Zeit in Amerika? Ist Ihnen da eines in Erinnerung, das für Sie persönlich auch besonders wichtig war?
Ja, eigentlich sind es die Gespräche mit Menschen außerhalb der Politblase. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine junge Frau Mitte 20, eines von diesen Dreamer-Kids, die ohne Papiere in den USA leben. Mit sieben kam sie über die Grenze aus Mexiko und hat bis heute noch keine Staatsbürgerschaft. Sie sagte mir: „Ich habe keine andere Heimat. Ich kenne kein anderes Land mehr.“ Die Probleme der Dreamer-Kids sind bis heute ungelöst. Als Donald Trump kam, sprach ich auch mit einem Automechaniker, der eine kleine Werkstatt hatte in Fargo, North Dakota – ein Mann, der total zu Donald Trump stand, Vertreter einer typischen Mittelklasse-Familie, nicht ungehobelt wie so viele Trump-Anhänger. Das sind sehr stille, leise Geschichten, die einem mehr vom Land und seinen Nöten erzählen als das laute Getöse der Medien und Politik.
Zum Schluss noch eine Frage zum Lebensgefühl in den USA: Was unterscheidet das Leben dort von jenem in Österreich?
Ich glaube, es ist die Grundeinstellung: individualistisch, freiheitsvernarrt, gegen eine zu starke Regierung, die überall eingreift. Es ist diese Kultur von „Failure is part of success“. Wenn ich einen Fehler mache, dann falle ich auf die Nase, habe daraus gelernt und mache weiter. Es ist auch die Bereitschaft, immer wieder etwas Neues anzufangen. Ich kenne Leute, die zwei-, dreimal in ihrem Leben etwas völlig Neues gemacht haben – Menschen über 70, die einen neuen Job anfangen. Nicht, weil sie müssen, sondern weil sie wollen, weil es ihnen Spaß macht. Das mag ich in Amerika – dieses Gefühl der enorm großen Freiheit, diesen Optimismus.
Vielen Dank für das Gespräch!
Zur Person
Hannelore Veit
* 1957 in Wien, blickt auf eine sehr erfolgreiche journalistische Karriere zurück. 19 Jahre hatte Veit die Zeit im Bild moderiert, acht Jahre lang war sie USA-Korrespondentin des ORF in Washington. Die Moderatorin und Kommunikationstrainerin ist seit Jänner 2021 selbstständig, sie pendelt zwischen Österreich und den USA.
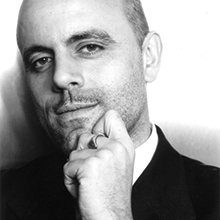









Kommentare