
Braucht Kunst ein Gehäuse?
Die Landesgalerie als Wiedergänger – zeitgenössische Kunst, vorübergehend präsentiert im vorarlberg museum
Über Kunst konnte man sich immer schon trefflich streiten. Das fängt mit der Frage an, was Kunst ist und was nicht, und setzt sich fort mit der Frage, was gute und was schlechte Kunst ist, und ob Kunst, welche Kunst und durch wen und auf welche Weise gefördert werden soll oder lieber nicht. Spätestens dann ist klar: Es handelt sich um ein Politikum.
In der Renaissance wurde durch die Herauslösung des Kunstschaffens aus religiösen Zusammenhängen die Entstehung und Karriere des Künstlers erst möglich. Er wurde nun zu jenem Magier, der Bürgern, Adeligen und gar Fürsten und Königen einen Spiegel vorzuhalten vermochte, ihnen die Welt neu erschuf. Um das Kunstwerk begann sich ein eigener säkularer Kult zu formieren, der in der Schaffung einer neuen nationalen Institution gipfelte – dem Museum. Große museale Prunkbauten entstanden Ende des 18. und im Verlauf des 19. Jahrhunderts, die nun die einstige fürstliche Schatz- und Kuriositätenkammer, andererseits die Sakralkunst in den Kirchen und Domen ergänzte und teils ersetzte. Gleichzeitig begannen die Künstler fortwährend ästhetische Normen zu sprengen. Sie verließen die traditionalistischen Akademien, gründeten Sezessionen, ließen figurale Prinzipien und Gegenständlichkeit hinter sich, entdeckten die Abstraktion bis hin zum „Schwarzen Quadrat“ von Malewitsch 1915. Wer glaubte, dass das ein Endpunkt war, sah sich getäuscht: Die diversen ästhetischen Sprengsätze wurden stetig weiterentwickelt und eroberten sich alle denk- und praktizierbaren Umgangs- und Kommunikationsformen.
Währenddessen wurden im 19. und 20. Jahrhundert in vielen europäischen Ländern Museen eingerichtet, selbst in den einzelnen Kronländern des Habsburgerstaates. Diese Landesmuseen waren allerdings keineswegs nur der bildenden Kunst gewidmet. In Vorarlberg wurde ein Museumsverein 1857 gegründet, ein eigenes Museum 1905 eröffnet. Es diente vor allem dem Zweck, Naturalien zu sammeln und Kunst- und Kulturgüter vor dem Verkauf ins Ausland und vor Zerstörungen zu retten. Außerdem ging es um die Präsentation und Lagerung der archäologischen Artefakte. Die Sammlung historischer Quellen und Dokumente war schon um 1900 an das Landesarchiv abgetreten worden. Die vier Säulen waren also Naturkunde, Kunst, Volkskunde und Archäologie. Allerdings wurde die naturkundliche Sammlung schon in den 1930er-Jahren ausgegliedert, daraus entstand die „Vorarlberger Naturschau“, die heutige „inatura“ in Dornbirn. Wie die Prioritäten gesetzt wurden, ist klar: Bis 2006 wurde das Bregenzer Museum von Archäologen und Ur- und Frühhistorikern geleitet. Während die archäologischen Funde in Vorarlberg systematisch gesammelt wurden, wurde dezidiert keine Gegenwartskunst erworben. Das wurde ab 1974 einer von der Landesregierung eingesetzten Kunstkommission überlassen.
Während die aus dem Landesmuseum ausgegliederte naturkundliche Sammlung 1960 ein eigenes Haus bekam, dauerte es mit den Überlegungen zu einem Haus für die Bildende Kunst noch bis 1990. Und als die – vor allem von Kunstvereinsfunktionären – geforderte Landesgalerie schließlich zwischen 1990 und 1997 als Kunsthaus Bregenz errichtet wurde, stellte sich alsbald heraus, dass sie nicht der Vorarlberger Kunst gewidmet war. Darin lag eine tiefere, allerdings nicht von allen akzeptierte Logik: Durch die Entwicklungen des ästhetischen Feldes ist das Kunstwerk längst auf eine vielfältige Weise ortlos und damit entheimatet. Als die großen Nationalmuseen im 19. Jahrhundert errichtet wurden, kamen diese Gebäude für die Kunst eigentlich schon zu spät. Was lebendige Kunst war, ließ sich nicht mehr in ein noch so prunkvolles Gehäuse sperren. Und umgekehrt kann ein Haus, das moderne Kunst präsentiert, kein Museum im klassischen Sinn mehr sein: Es muss, um der modernen Kunst gerecht werden zu können, Durchgangsstation sein, ein Ort temporärer Möglichkeiten und vielfältiger Kombinationen. Nun stellt sich aber die Frage, ob Künstler und Kunstvereinsfunktionäre, die nach wie vor eine Landesgalerie fordern, nur althergebrachten Denkmustern und einer Proporz- und Sozialpartnerlogik verhaftet sind. Ihr Unbehagen angesichts der Transformationen im ästhetischen Feld und im weiteren Sinn auf dem Kunstmarkt und in der Kulturszene findet seine Kehrseite in der verständlichen Sehnsucht nach einer Heimat für Werke der heimischen Künstlerschaft. Die Depots, in denen die Kunstkommission ihre in der Gesamtheit nicht ausstellbaren Ankäufe (jährliches Budget ca. 90.000 Euro) lagert, bieten diese Heimat nicht, werden jedoch vom vorarlberg museum verwaltet. Dieses selbst erwirbt etwa mit dem gleichen Budget Kunstwerke aller Epochen. Unter Andreas Rudigier gab man die Maxime auf, nur Werke toter Künstler zu kaufen. Während früher nur alle paar Jahre die Ankäufe der Kunstkommission ausgestellt wurden, soll nun regelmäßig in wechselnder Form eine Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst stattfinden. Demnächst wird eine Auswahl von Christine Lederer unter dem Titel „Greatest Hits by“ präsentiert. Ist der neue, offene Umgang mit zeitgenössischer Kunst den Kunstinteressenvertretern zu wenig? Kann der immer wieder auftauchende alte, neue Wunsch nach einer Landesgalerie den Anforderungen an gegenwärtige Entwicklungen in der Kunst gerecht werden? Deren Produzenten sind auf Verständnis für ihre Einsätze, eine dezentralisierte, auch private Unterstützung, auf Hilfsbereitschaft und öffentliches Interesse angewiesen. Brauchen sie ein Landeskunstgehäuse?





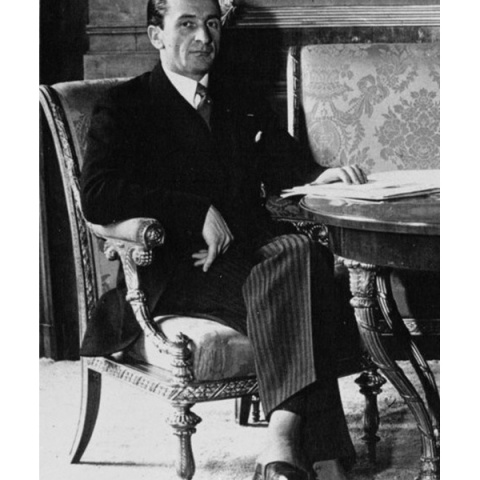


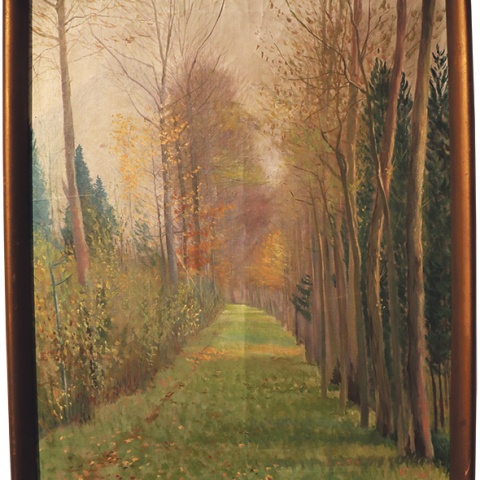




Kommentare