Red Dütsch!
Dem Vorarlberger muss ja niemand den Dialekt erklären, odr? Welches Fundament vom „schaffa, schaffa, Hüsle baua“ noch steht und wo Landschaften zu Lautschaften werden.
Die Dorfsprache war für die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller nicht nur der urtümlichste Zugang zu den Worten, sie war auch der urtümlichste Zugang zur Welt: „Die Dinge hießen genauso, wie sie waren, und sie waren genauso, wie sie hießen. Ein für immer geschlossenes Einverständnis“ – so beginnt ihr Essay „In jeder Sprache sitzen andere Augen“. Sprache wird aber längst nicht mehr nur auf ihre referentielle Funktion reduziert – darüber ist sich seit dem späten Wittgenstein nicht nur er, sondern fast die gesamte Sprachphilosophie einig. Der sogenannte „Pragmatic Turn“ der Philosophie – was Sprache alles kann! Und was sie alles macht! Und welche Macht! – hat die Sprache aus ihrem passiven Untertanendasein befreit und die Ohren geöffnet für das, was sie selbst zu sagen hat. Und das war mehr, als manch einer vielleicht hören wollte. Von der Erschaffung sozialer Identität über Machtausübung bis hin zur Welterschließung ist Sprache keine unpolitische, private Angelegenheit mehr – und ein Wort niemals nur ein Wort. Auch, oder gerade, im Dialekt nicht.
Im Dorf ist niemand einsam, er ist allua, alloa, alloanig. Es gibt nur eine Vergangenheit, und die isch gsi. Niemand besitzt hier was im Genitiv, ein von steht immer zwischen uns und den Dingen. Hier weht kein Wind, er goht. Und das, was die Wissenschaft in ihrer Fachsprachlichkeit sagt, kann man, dem Mundartförderer und -künstler Ulrich Gabriel zufolge, im Dialekt nicht wiederholen. Wenn in jeder Sprache andere Augen sitzen, so hat der Dialekt, wie Gabriel meint, mit seinen regionalen, örtlichen, lokalen einen Blick fürs Alltägliche. Und das war vor allem von harter Arbeit geprägt: „Schwerstarbeit wie Säcketragen, Umgraben, Hacken, mit der Sense mähen war eine Schule des Schweigens. Der Körper war zu beansprucht, um sich im Reden zu verausgaben“, schreibt Herta Müller. Auch Gabriel sieht in den Lebensrealitäten der Landwirtschaft das Saatgut für den Dialektwortschatz. „Da braucht man nicht so viele Wörter“, schließt er wissentlich, dass es in manchen Bereichen dafür umso mehr anderer bedurfte. Was ein Höùlüchar ist, weiß niemand, der noch nie geheut hat. Fensterläden gibt es auch woanders, aber nirgends bricht sich der Lällar so gekonnt wie im Gadolada. Und in allpot und ghörig verstecken sich mit Gebot und Gehörig Anklänge an den Glauben. Umso verwunderlicher fast, wie sich mit hargoles oder hargolante Herkules in die monotheistischen Gefilde eingeschlichen hat. Was all die fehlenden Wörter sagen, ist also keine Spracharmut. Vielmehr verweisen die Lücken auf Alltagsrealitäten und ihre Entwicklungen, oder werden gar gefüllt mit all jenen, für die es im Standardsprachlichen kein Äquivalent, weil keine Lebenswirklichkeit, gibt. Aber die Mundart spricht ja nicht nur in Worten, sondern vor allem in Lauten.
„Sie leistet nicht, was die Schriftsprache leistet. Und umgekehrt leistet die Schriftsprache nicht, was die Lautsprache leisten kann“, charakterisiert Gabriel den Dialekt. Die Verschriftlichung von Mundart, die in der Form, wahrscheinlich auch der Pragmatik qua Schnelligkeit geschuldet, erstmals mit dem SMS Einzug in den Alltag gehalten hat, findet zwar auch in der Lyrik oder Musik einen Nährboden, im alemannischen Sprachraum ist der allerdings noch verhältnismäßig verwildert. Man denke an Gerhard Rühm, HC Artmann und die Wiener Gruppe oder die wellenschlagenden Erfolgserlebnisse des Austropop, der übrigens seit kurzem ein Revival feiert. Dass Vorarlberger Mundarten dabei vergleichsweiße unterrepräsentiert – oder unterrezipiert – sind, liegt nicht zuletzt daran, dass die „Transportmöglichkeit viel größer über die bairischen Dialekte funktioniert, als über alemannische, die außerhalb ihrer Sprachgrenzen, kaum einer versteht“, sagt Gabriel, der mit „red dütsch“ 2015 eine Anthologie Vorarlberger Dialektlyrik veröffentlicht hat. Die Mehrdeutigkeit, die sich nicht nur an der Auslegung des Titels zeigt, sondern dem Dialekt generell innewohnt, deckt sich mit den Ansprüchen der Lyrik, immer mehr zu sagen, als die Syntax den Worten vorgibt. Dass bei der Übersetzung ins Standarddeutsche dabei auch immer etwas verloren geht, das nicht den Wörtern per se, sondern vielmehr ihrem Klang und ihrer Lautsprachlichkeit anhängt, vergleicht Gabriel auch mit einem „englischen Rasen“ auf der einen Seite und einer „bunten Wiese“ auf der anderen. Gerade deshalb, gehört Mundartlyrik, Gabriel zufolge, aber auch nicht auf den Zettel, sondern vielmehr gehört – „im lautlichen Bereich sieht man erst, was das für eine Nivellierung ist! Du kannst dich doch nicht ausdrücken in 26 Buchstaben!“ Dass diese Nivellierung den Nährboden nicht nur unbewirtschaftet lässt, sondern gar betoniert, ist allerorts kundgetane Sorge. Das, was Martin Walser als „Vertreibung aus dem Paradies, in dem alle Wörter stimmen“ bezeichnet, und Herta Müllers „für immer geschlossenes Einverständnis“ verwischt, ist nicht nur sprachliche Orientierungslosigkeit, sondern Heimatlosigkeit.
Den Dialekt mit Martin Walser, oder auch Ulrich Gabriel, „als Pflegefall“ zu begreifen, widersetzt sich also nicht nur seiner jahrelangen Abwertung und Vernachlässigung, sondern auch dem Identitätsverlust. Die Sicherheit, die Sprache gibt, ist aber nicht nur als geographisches Zuhause verortbar, sondern vor allem als eines, das man mit sich mitträgt. „Aus Sprache ist Heimat“ wird bei Herta Müller nach einiger Überlegung „Heimat ist das, was gesprochen wird“ und das ist ein kleiner aber wesentlicher Unterschied. Wenn Inhalte vertraute Laute zu fremden Klängen verzerren, kann das die instinktive Beziehung zur Muttersprache auch erschüttern. Sprache hat Geschichte, nur wird die oft vergessen. Wenn von Heimatschutzvereinen propagiert wird, den Dialekt zu schützen, könnte man sich auch anmuten zu fragen, ob denn Einflüsse und Wandel tatsächlich als Bedrohung verstanden werden müssen, wo doch der Dialekt aus ebendiesen erst entstanden ist. Wessen Sprache also ist der Dialekt? „Die von allen“, sagt Gabriel und meint damit nicht nur „das einfache Volk“, sondern vor allem die sprachgeschichtliche Entwicklung: Am Anfang war s Wort, dann kam das Wort. „Es gab drei Bewegungen und damit Gründe, warum man die Sprache nivelliert und Lautliches vereinheitlicht hat.“ Dazu gehören, Gabriel zufolge, die Kirche, der Handel und die Politik, die zwischen 15. und 16. Jahrhundert ihre Macht ausweiten wollten – über die Landes- und Sprachgrenzen hinweg. Man könnte also fast sagen: Die Muttersprache der Standardsprache ist die Mundart.
Solange Landschaften aber noch Lautschaften sind, hört man das Dorf im Dialekt. Wenn da einer fragt Hosch Böda? Kann man ihm getrost antworten: Abr jô!

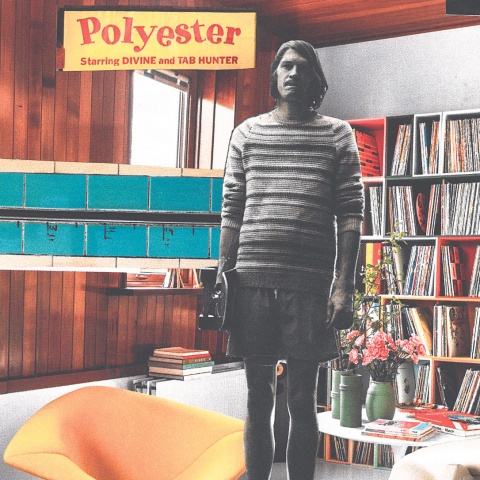








Kommentare