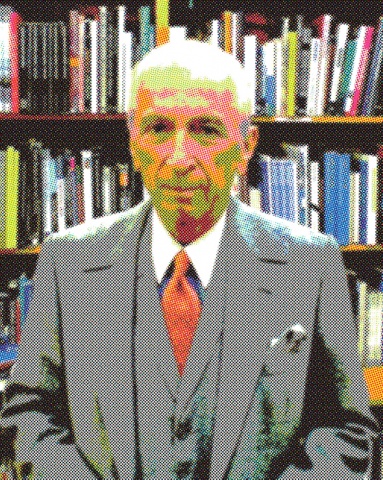
„Sinatra mit Schnupfen ist wie Picasso ohne Farbe – nur schlimmer“
Diesmal stellt Ihnen Gerald A. Matt den von ihm geschätzten Journalisten und Autor Gay Talese vor. Taleses im Esquire publizierten Porträts von Joe DiMaggio, Dean Martin und Frank Sinatra sind journalistische Legende. Seine nach mehrjährigen Recherchen erschienenen Bücher, darunter der Bestseller „Honor Thy Father“ über die mächtige New Yorker Mafia-Familie Bonanno und sein Buch über die sexuelle Revolution in Amerika, „Thy Neighbor’s Wife“, gelten als Musterbeispiele des „New Journalism“. Darüber hinaus gilt der mittlerweile 90-jährige, exzellent gekleidete Talese als New Yorker Stilikone.
Es sind nunmehr mehr als dreißig Jahre, als mich Bürgermeister Helmut Zilk bat, einem Gast der Stadt Wien, dem Autor Gay Talese, seiner Frau Nan, einer bekannten New Yorker Verlegerin, und seiner damals noch kleinen Tochter Pamela, heute eine bekannte Malerin und liebe Freundin, die Stadt, ihre Sehenswürdigkeiten und Skurrilitäten zu zeigen. Besonders hatte es Talese die Kapuzinergruft und insbesondere der monumentale, drei Meter lange Sarkophag Maria Theresias angetan, der sich auf einem Marmorsockel erhebt und auf acht wuchtigen Schnörkelfüßen in der Mitte von einem Adler gestützt und mit Totenköpfen dekoriert wie ein barockes Raumschiff einem imaginären Himmel entgegenschwebt. In starkem Kontrast hierzu steht der schlichte Sarg ihres Sohnes, des Aufklärungskaisers Joseph II., auf dessen Deckel sich als einziger Schmuck ein einfaches Kreuz und eine kleine Kupferplatte mit Inschrift befindet. Talese amüsierte dieser Kontrast und noch mehr die Geschichte des sogenannten „Sparsarges“, den der Kaiser 1785 einführen ließ – ein Sarg, der mehrmals verwendet werden konnte. Der Holzsarg war an der Unterseite mit einer Klappe ausgestattet, durch die der beziehungsweise die Tote in das Grab gelassen werden konnte. Die Wiener zeigten sich von dieser Spar- und Rationalisierungsmaßnahme wenig begeistert und protestierten. Nach nur sechs Monaten musste Joseph die Verordnung wieder außer Kraft setzen.
Talese erzählte mir, dass er nach seinem Militärdienst, blutjung, ein Jahr lang in der Nachrufredaktion der Times tätig war. Gerne scherzte er, hätte er Nekrologe für Kaiserin Maria Theresia und ihren Sohn geschrieben – der allerdings schlechter weggekommen wäre als seine Mutter –, habe er doch, und das sagte er als gebürtiger Italo-Amerikaner und Katholik, „am falschen Ort, nämlich an der Ewigkeit, gespart“. Verständlich, dass das gerade im todesverliebten Wien schlecht ankam.
Gay Talese und seine Frau Nan erwiesen sich nicht nur als außergewöhnliche Gesprächspartner voller Esprit und Humor, sie – und im Besonderen Gay Talese – waren auch umwerfend gut gekleidet.
Später erfuhr ich, dass Talese nicht nur ein amerikanischer Starautor und Journalist war, sondern auch als einer der bestgekleideten New Yorker galt, war doch sein aus Kalabrien stammender Vater Maßschneider und stattete ihn schon in früher Jugend nicht nur mit perfekt geschnittenen Anzügen, sondern auch mit einem exquisiten Geschmack für Stoffe und Schnitte aus. So verlässt Talese seine Wohnung in Manhattan nie ohne Hut, dreiteiligen Anzug, aufeinander abgestimmte Schuhe, Stecktuch, Strümpfe.
Er wurde Mitbegründer des New Journalism, eines literarisch anspruchsvollen Journalismus, der diesen Namen einer Artikelsammlung von Tom Wolfe, einem ebenfalls exzentrisch – aber stets in Weiß gekleideten – Dandy und wunderbaren Autor, verdankt. So bediente sich Talese literarischer Mittel, die man aus der Belletristik kennt. Autoren wie Lillian Ross in ihrem Buch Picture (1952) oder Truman Capote mit seinem Werk The Muses Are Heard (1956) sollten ihm folgen.
Am Anfang seiner Geschichten setzt Talese immer wieder kleinste, neugierig machende Details, die sofort mitten in die Geschichte, in medias res, wie er es nannte, führten und den Leser nicht mehr loslassen. Talese sagte dazu: „Artikel wie Kurzgeschichten zu schreiben – mit subjektiven Eindrücken. Das gab es in den 1950er-Jahren kaum. Ich berichtete über die Parlamentssitzungen in Albany, der Hauptstadt des Bundesstaates New York, und erwähnte die Spucknäpfe unter den Abgeordnetenpulten. Das hat mir die Redaktion der New York Times rausgestrichen.“
Dabei richtete er seinen Blick insbesondere auf die Verlierer, die Nebenfiguren und Unbeachteten, ohne die es keine Sieger gäbe; die bloße Heldenverehrung der Gewinner interessierte ihn nicht. Talese berichtete schon mit 15 Jahren für eine Lokalzeitung über die Baseballspiele an seiner Schule. Zu seiner Zeit als Sportreporter am Beginn seiner Karriere Mitte der 50er-Jahre bei der New York Times sagte er: „Sport – da geht es um Leute, die verlieren, verlieren und verlieren. Sie verlieren Spiele und dann verlieren sie ihre Jobs. Das kann sehr interessant sein.“ Von den verschiedenen Sportarten liebte er besonders das Boxen. So schrieb Talese alleine 38 Artikel über den schwarzen US-Boxweltmeister Floyd Patterson.
Berühmt machte ihn jedoch sein 1966 im Esquire erschienener Artikel über Frank Sinatra: „Frank Sinatra Has a Cold“. Als einer der einflussreichsten amerikanischen Magazinartikel aller Zeiten gilt er heute noch angehenden amerikanischen Journalisten als Pflichtlektüre für meisterhaften Journalismus und als Musterbeispiel für den literarischen Stil des New Journalism. Als er sich Anfang der 1960er um ein Interview mit dem Star bemühte, ließ ihn Sinatras Agent wissen, dass sein Chef wegen eines Schnupfens unpässlich sei. Talese ließ sich durch diese Zurückweisung nicht entmutigen und reiste Sinatra wochenlang nach, quartierte sich in denselben Hotels ein, folgte ihm auf Schritt und Tritt. Und er befragte das Umfeld des Sängers und Schauspielers – seine Mutter, seine Freunde und Familie, seine Entourage, seine Sekretäre, Toupetfriseuse, Chauffeur, Maskenbildner, Saufkumpanen und Ex-Ehefrauen – und hielt alles in Memos und Skizzen fest. Er wusste, dass Tonbandaufnahmen Gesprächspartner einschüchtern und weniger auskunftsfreudig machen. So entstand ein großartiges Porträt von Sinatra – und dies, obwohl Talese ihn nie persönlich traf und das Interview mit ihm nie zustande kam. „Sinatra mit Schnupfen ist wie Picasso ohne Farbe, Ferrari ohne Sprit – nur schlimmer“, schrieb Talese.
Talese interviewte für seine Reportagen und Bücher mit Vorliebe Menschen wie du und ich – die Frau und den Mann von der Straße, Arbeiter, Polizisten, Kirchenchorsängerinnen, Studentinnen in Massagesalons – ebenso wie Berühmtheiten. Dabei änderte er nie die Namen seiner Protagonisten in den Reportagen und war geradezu versessen darauf, nur nachprüfbare Fakten zu präsentieren. In jeder Geschichte, die er erzählt, ging es ihm, wie er sagt, um einen „universellen Kern“. Anstelle von Fiktion ging es ihm immer um Realität, um Wahrheit – wenn es auch seine subjektive Wahrheit war. Noch heute tippt er am liebsten auf seinen alten elektrischen Schreibmaschinen. Notizen macht er sich auf Kartons aus seiner Wäscherei, die er in seinem Sakko unterbringt. Seine Recherchemethode bezeichnet er als „The Fine Art of Hanging Around“: die hohe Kunst des Wartens, des Herumlungerns, Beobachtens und Abhängens. Arbeitsweise und Interviewtechnik verdankte er, wie er in A Writer’s Life schrieb, seiner Mutter: „Ich lernte von ihr … mit Geduld und Aufmerksamkeit zuzuhören und die Leute niemals zu unterbrechen, selbst wenn die Leute stockend und unpräzise erzählten … worüber die Leute zögern zu erzählen, kann sehr viel über sie aussagen. Ihre Pausen, ihre Ausflüchte … zeigen an, was sie als zu privat oder zu heikel betrachten …“
Dieser Fähigkeit, mit Geduld, Beharrlichkeit und Empathie zuzuhören, verdankte er aufschlussreiche Gespräche und tiefe Einsichten für seine Artikel und Bücher – vom Ehrenkodex der italienischen Mafia bis hin zum Sexualleben des Durchschnittsamerikaners. So gelang es ihm, das Vertrauen des Mafiabosses Salvatore „Bill“ Bonanno zu gewinnen, den er sechs Jahre lang mit Interviews begleitete und neben ihm weitere Mafiagrößen und Soldaten befragen konnte. Auf Grundlage seines 1971 erschienenen Buches „Honor Thy Father“, das als eine der ersten großen Reportagen über die Mafia gilt, wurde ein Filmfeature gedreht. Taleses Bücher sind meisterhafte soziologisch-psychologische Porträts des American Way of Life und der amerikanischen Gesellschaft der letzten 50 Jahre. Dabei geht es um Sex und Crime, Familie, Politik und vor allem menschliche Leidenschaften.
Gay Talese ist ein wunderbarer Beobachter und Erzähler, dessen Bücher ich Ihnen gerne ans Herz lege.
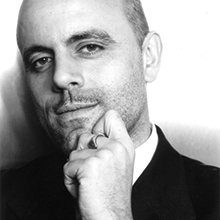







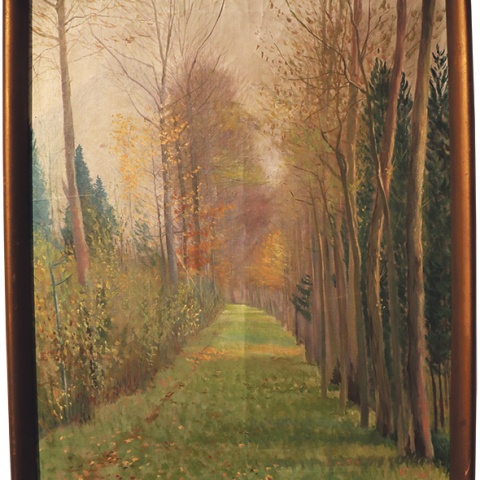


Kommentare