
Ungerechte Erbschaftssteuern?
Sollte man Erbschaften besteuern? Diese Frage ist ein immer wiederkehrendes politisches Streitthema. Manche Befürworter argumentieren, die Besteuerung von Erbschaften könnte in Zeiten knapper staatlicher Kassen zur Haushaltskonsolidierung beitragen. Besonders Politiker des linken Spektrums bezeichnen Erbschaftssteuern gerne als „gerecht“. Ein Gegenentwurf.
Um etwas über Gerechtigkeit zu sagen, braucht man ein Gerechtigkeitsprinzip. Betrachten wir die Geschichten zweier Personen: Beide gründeten in jungen Jahren ein Familienunternehmen, arbeiteten hart und waren fleißig. Im Ruhestand verkaufen sie ihre Unternehmen, zahlen Steuern auf den Erlös und verfügen schließlich über jeweils zehn Millionen Euro Vermögen, das sie für ihren Lebensabend nutzen möchten. Hier trennen sich ihre Wege: Die erste Person, Frau „Sparefroh“, lebt bescheiden. Sie genießt ihr Leben, achtet jedoch auf ihre Ausgaben, investiert ihr Vermögen in die Wirtschaft und fördert damit Wachstum und Innovationen. „Sparefroh“ möchte ihren Wohlstand später mit ihren Kindern, Enkeln, Nichten und Neffen teilen. Die zweite Person, Frau „Verschwenderisch“, geht einen anderen Weg. Sie nutzt ihr Vermögen für ein luxuriöses Leben mit teuren Reisen, exklusiven Hobbys und opulenten Partys. Gedanken an zukünftige Generationen macht sie sich nicht, und am Lebensende bleibt von ihrem Vermögen kein Cent mehr übrig.
Nun die Frage: Welches Gerechtigkeitsprinzip rechtfertigt, dass Frau „Sparefroh“ für ihre Sparsamkeit mit Erbschaftssteuern bestraft wird? Eine Erbschaftssteuer verstößt offensichtlich gegen das Prinzip der horizontalen Gerechtigkeit. Der Grundgedanke dieses Prinzips ist, dass ähnliche Personen eine vergleichbare Steuerbelastung tragen sollten.
Doch es geht noch weiter. Wenn man aus Gerechtigkeitsgründen dem Wohlstand der zukünftigen Generation ein positives Gewicht gibt, dann wären sogar negative Erbschaftssteuern gerecht. Das bedeutet, man sollte dann aus Gerechtigkeitsgründen Erbschaften subventionieren, nicht besteuern. Natürlich gibt es aber auch Gerechtigkeitsgründe, die für eine Besteuerung von Erbschaften sprechen, nämlich wenn man eine starke gesellschaftliche Präferenz für die Chancengleichheit von allen Kindern im Land annimmt.
So zeigt sich, dass man aus Gerechtigkeitsüberlegungen sowohl für als auch gegen Erbschaftssteuern argumentieren kann und sogar eine Subventionierung von Erbschaften gerecht sein kann. Insofern ist es nicht überraschend, dass Erbschaftssteuern ein wiederkehrendes politisches Streitthema sind.
Wohlfahrtskosten von Erbschaftssteuern
Mit Gerechtigkeitsargumenten kommt man bei der Diskussion über Erbschaften also nicht weiter. Insofern gilt es zu eruieren, ob Erbschaftssteuern effizient sind, in dem Sinne, dass sie weder die Anreize zur Akkumulation von Vermögen durch die Erblasser reduzieren noch Steuervermeidungsstrategien fördern.
Dabei ist klar, dass Erbschaftssteuern die Anreize zum Erhalt und Ausbau von Vermögen eher verringern. Für Erblasser wird es bei Erbschaftssteuern attraktiver, ein „verschwenderisches“ Verhalten an den Tag zu legen. Werden direkte Nachkommen steuerlich stark belastet, wie es beispielsweise in Deutschland der Fall ist und wie es manche Befürworter einer (Wieder-)Einführung von Erbschaftssteuern in Österreich fordern, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Erblasser oder Erben verstärkt versuchen, diese Steuern zu umgehen. Bei Erbschaftssteuern lohnt sich die Umgehung besonders, da sie nur einmal anfallen. Erblasser und Erben gehen also nur ein einmaliges Risiko ein, was Anreize setzt, Grauzonen exzessiv auszunutzen.
Der politische Druck, bei der Vererbung von Unternehmen oder Immobilien großzügige Ausnahmen von Erbschaftssteuern zuzulassen, nimmt ebenfalls erheblich zu. In fast allen Ländern mit Erbschaftssteuern werden deshalb vererbte Unternehmen und Immobilien steuerlich begünstigt, um negative wirtschaftliche Folgen und politischen Widerstand zu reduzieren. In Österreich hatte der Verfassungsgerichtshof im Jahr 2007 die erbschaftssteuerlichen Regelungen für verfassungswidrig erklärt, da die Bewertungsvorschriften für Grundstücke gegen den Gleichheitsgrundsatz verstießen.
Am Ende belasten Erbschaftssteuern in der Regel daher nicht „große“ Erbschaften, sondern vielmehr kleinere und mittlere Nachlässe, für die sich teure Steuervermeidungsmodelle weniger lohnen. Dennoch versuchen auch sie Erbschaftssteuern zu umgehen, indem beispielsweise Bargeld gehortet wird oder Immobilien vorab zu marktunüblichen Preisen an die Erben verkauft werden.
Unter dem Strich sind Erbschaftssteuern mit relevanten gesamtwirtschaftlichen Kosten sowie bei Durchsetzung mit einem hohen Verwaltungs- und Kontrollaufwand verbunden, während die Steuereinnahmen realistisch betrachtet eher gering bleiben. In Österreich lag das Aufkommen der Erbschaftssteuer vor ihrer Abschaffung meist bei weniger als 150 Millionen Euro jährlich und damit weniger als der hälftige Förderbetrag der Bildungskarenz.
Gemeinden als gesetzliche Erben
Nun ist wichtig festzuhalten, dass all diese Argumente nicht grundsätzlich gegen Erbschaftssteuern sprechen. Sie richten sich vielmehr gegen eine Besteuerung von Nachlässen, bei denen die Erblasser bestrebt sind, ihre Nachkommen möglichst zu begünstigen.
Ein alternativer Ansatz bestünde daher darin, Erblasser dazu zu ermutigen, freiwillig einen Teil ihres Nachlasses an den Staat – idealerweise an die Gemeinden – abzugeben. Was zunächst ungewohnt klingt, ließe sich einfach umsetzen, indem der Staat als gesetzlicher Erbe berücksichtigt wird.
Beispielsweise könnten Gemeinden 15 Prozent des Nachlasses als gesetzlichen Erbteil zugewiesen werden. Erblasser, die ihrer Gemeinde nichts hinterlassen möchten, könnten diese problemlos im Testament enterben – ohne kostspielige Umgehungsstrategien. Gleichzeitig könnten Erblasser ohne enge Bindung zu ihren Nachkommen den Staat beziehungsweise ihre Gemeinde einfach erben lassen. Es gibt Eltern, die ihre Kinder nicht (mehr) lieben und daher möglicherweise lieber ihre Heimatgemeinde am Erbe teilhaben lassen würden.
Auf diese Weise würde der Staat ohne gesellschaftliche Wohlfahrtskosten eine gewisse finanzielle Unterstützung erhalten. Darüber hinaus würde ein solches System die Gemeinden und ihre Bürgermeister motivieren, sich liebevoll um potenzielle Erblasser zu kümmern – denn es gibt ja für sie dort etwas zu holen.




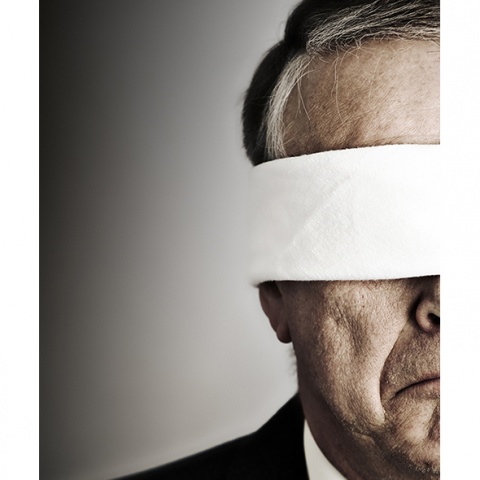








Kommentare