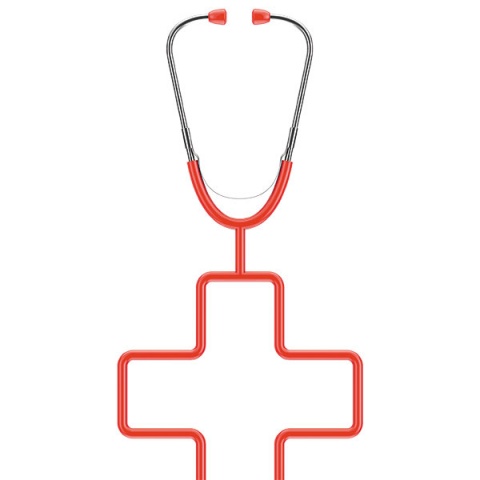
Vom Einzelkämpfer zum Teamplayer
Die Zeiten, als der Landarzt rund um die Uhr und sieben Tage die Woche für seine Patienten erreichbar war, sind vorbei. Es wird immer schwieriger, Nachwuchs zu finden für die in Pension gehenden Hausärzte. Krankenkassen und Ärztekammer suchen Rezepte gegen eine mögliche Krise.
Schoppernau ist auf der Suche nach einem praktischen Arzt. Schruns auch. Andere Gemeinden haben lange gesucht, bis sich jemand fand, der den Job und eine freiwerdende Praxis übernimmt. „Es wird immer schwieriger, Kassenstellen in kleineren Gemeinden zu besetzen“, sagt Manfred Brunner, Obmann der Vorarlberger Gebietskrankenkasse (VGKK). Es gelinge zwar und man habe in den vergangenen drei Jahren sogar 15 neue Stellen geschaffen und besetzt, aber es würden sich immer weniger Ärzte bewerben. Nicht selten müsse man auch im Ausland suchen. In den kommenden Jahren droht weiteres Ungemach: 2020 werden nach Berechnungen der VGKK 32 niedergelassene Allgemeinmediziner zumindest 65 Jahre alt sein, bis 2025 kommen weitere 40 dazu. Kurz: In den nächsten zehn Jahren gehen rund 25 Prozent der Vorarlberger Hausärzte in Pension. Ob sich für sie Ersatz findet, wird von vielen Faktoren abhängen.
Da ist zum einen das auch nach einer Reform noch lange dauernde Studium, das Ärzte vor allem auf die Arbeit im Spital vorbereitet. „Viele junge motivierte Vorarlberger wollen Medizin studieren, doch nur ein relativ geringer Prozentsatz von ihnen schafft die Zulassung zum Medizinstudium. Der Eignungstest für das Medizinstudium ist zu hinterfragen. Derzeit liegt der Fokus auf naturwissenschaftlichem Wissen und Abstraktionsvermögen. Sozialkompetenz kann im Multiple-Choice-Test nicht in Erfahrung gebracht werden“, sagt Vorarlbergs Ärztekammer-Präsident Michael Jonas. Anders formuliert: Wer einen wissenschaftlichen Kreuzerltest schafft und auch das Studium weitgehend so absolviert, entwickelt wenig Kompetenz für die Arbeit mit Menschen.
Jonas: „Es ist aber gerade auch die zwischenmenschliche Komponente, die oft den Unterschied macht, ob ein Arzt in die Praxis geht oder eine wissenschaftliche Karriere vorzieht.“ Statt dem Eignungstest fordert er mehr Praxis in der Studieneingangsphase. Nicht zuletzt das stärker verschulte Studium führt auch dazu, dass längst nicht alle Medizinstudenten nach ihrem Studium als Ärzte arbeiten. „Die Zahl der Absolventen, die entweder nie in den Beruf einsteigen oder kurz danach wieder aussteigen, steigt von Jahrgang zu Jahrgang“, sagt Jonas. Über ein Drittel der Absolventen gehe zudem ins Ausland. „Für Hausarztstellen besteht kaum mehr Interesse. Das European Health Forum beziffert die Zahl der fehlenden Ärzte im Jahr 2020 in Europa mit 230.000. Es dürfte daher auch immer schwerer werden, Ärzte von außerhalb zu finden, die sich in Vorarlberg niederlassen.“
Dazu kommt, dass Jungärzte in den Spitälern einerseits lernen, in multiprofessionellen Teams zu arbeiten, und gleichzeitig – nicht zuletzt aus juristischen Gründen – lernen, Diagnosen möglichst technisch abzusichern. Ein langjähriger, vor der Pension stehender Arzt formuliert das so: „Früher konnte ein Hausarzt einen Blinddarm händisch diagnostizieren, heute sichern sie das im Spital mit einem CT ab.“ Jungärzte sind also auf eine verantwortungsvolle Arbeit des Einzelkämpfers in einer Gemeindepraxis kaum vorbereitet.
Dazu kommen die fehlende wirtschaftliche Erfahrung und das entsprechend hohe Risiko. Denn der Start einer Praxis ist mit hohen Kosten verbunden. Und selbst die Nachfolge bei einem Kassenvertrag kann teuer kommen. Denn das bestehende System der Ärzte baute bisher darauf auf, dass Nachfolger ihren Vorgängern die Praxis und die bestehenden Patienten ablösen.
Geholfen hat dabei in vielen Fällen, wenn eine Gemeindepraxis mit einer Hausapotheke ausgestattet war. Der Arzt konnte sich so, mangels einer stationären Apotheke im Ort, mit der Abgabe von Arzneimitteln ein Zubrot verdienen. Das sehen aber nicht nur Apotheker skeptisch. „Es kann nicht sein, dass ein Hausarzt auf eine Hausapotheke angewiesen ist. Wenn das so ist, stimmt im System etwas nicht. Man sollte das Thema Hausapotheke und Einkommen nicht verknüpfen. Natürlich gibt es Gegenden, wo eine ärztliche Hausapotheke sinnvoll ist – aber dann soll sie es eben nur aus dem Blickpunkt der Versorgung sein“, sagt der Salzburger Arzt und Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, Christoph Dachs. „Im künftigen allgemeinmedizinischen System brauchen wir für unsere ureigenste Aufgabe eine entsprechende und adäquate Entlohnung.“
Ein weiterer Druck entsteht aufgrund der aktuellen Reformdebatte im Gesundheitssystem. Krankenkassen und Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser wollen sogenannte Primärversorgungszentren (PHC) schaffen, bei denen mehrere Ärzte und Vertreter anderer Gesundheitsberufe zusammenarbeiten. Dadurch sollen die Öffnungszeiten verlängert, Ärzte entlastet und vor allem die teuren Ambulanzen in Krankenhäusern weniger frequentiert werden. Das klingt zwar aus Sicht der Patienten gut, für jene Ärzte, deren Pensionierung ansteht, und für die Ärztekammer ist es aber eine Drohung.
Kommt nämlich ein PHC, ersetzt es womöglich eine bestehende Praxis. Ihr Verkauf im Fall einer Pensionierung wird dadurch schwer bis unmöglich. Viele ältere Ärzte haben die Einnahmen aber einkalkuliert. Die Ärztekammer wiederum fürchtet ganz generell um die Pensionsversicherung der Ärzte. Denn die zahlen eine Kammerumlage, aus der die berufsgruppeninterne Pension finanziert wird. PHC könnten, so sie als Unternehmen geführt werden, in der Zuständigkeit von der Ärztekammer zur Wirtschaftskammer wandern. Die Einnahmen für die Pensionskasse sind dann weg.
Offiziell klingt das natürlich anders. „Obschon wir im Land bereits über eine sehr gute Vernetzung im hausärztlichen Bereich verfügen, unterstützt die Ärztekammer alle Initiativen für eine weitere gezielte Stärkung der Primärversorgung in unserem Land. Das Rad muss aber nicht neu erfunden werden. In vielen Ordinationen wird seit langem – ohne neues PHC-Gesetz – eine optimale medizinische Primärversorgung zum Wohl und zur vollsten Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten betrieben“, sagt Jonas. Soll heißen: Primärversorgung ja, aber in der Hand der Ärzte und in den bestehenden Praxen. Prinzip jeder Maßnahme zur Stärkung der Primärversorgung mit intensiver Zusammenarbeit aller Gesundheitsberufe müsse der Gedanke sein, auf bestehenden Strukturen aufzubauen, diese zu stärken und zu erweitern sowie teilweise noch bestehende Versorgungslücken zu schließen, ohne funktionierende Strukturen abzuschaffen, argumentiert der Ärztekammer-Präsident.
Bleibt die Frage, wie man junge Ärzte motivieren kann, aufs Land zu ziehen. Und hier wiederum ziehen Gebietskrankenkasse und Ärztekammer dann doch an einem Strang: „Wir haben zusammen mit der Ärztekammer familienfreundliche Modelle geschaffen, wo sich etwa zwei Ärzte auch eine Kassenstelle teilen können und jeweils 75 Prozent oder 100 plus 50 Prozent arbeiten. Auch das Honorarsystem wurde umgestellt und Deckelungen aufgehoben“, sagt Kassenobmann Brunner. Auch bei der Lehrpraxis – einer einjährigen Ausbildung am Studienende in einer Hausarztpraxis – ist Vorarlberg österreichweit tonangebend. „Mit der Einführung eines Pilotprojekts für Lehrpraxen im Zusammenwirken mit Bund, Land und Gebietskrankenkasse konnte in Vorarlberg ein erster Schritt und Lösungsansatz in Richtung einer Qualitätsverbesserung in der allgemeinmedizinischen Ausbildung erzielt werden. Damit wird es den Lehrpraktikanten möglich gemacht, in einer allgemeinmedizinischen Praxis Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten für die selbstständige Führung einer Ordination zu erlernen, die sonst im stationären und ambulanten Spitalsbereich nicht erworben werden können“, erklärt Jonas. Diese Maßnahme alleine werde aber nicht ausreichen, die kassenärztliche Versorgung im Land dauerhaft sicherzustellen, ist er überzeugt. Er will mit der Kasse daran arbeiten, den Hausarztberuf attraktiver zu machen.













Kommentare