Die Krise ist nicht ausgestanden
Die schreckliche Flüchtlingsflut, Hilflosigkeit, Taktieren und Streit der verantwortlichen Regierungen, dazu anhaltender Krieg in Syrien und Terror in Europa haben das Thema Griechenland-Krise etwas aus den Schlagzeilen verdrängt. Erst das blamable Brexit-Votum hat wieder etwas Licht auf den Fall Grexit geworfen. Dies mag daran erinnert haben, dass „Griechenland“ und die europäische Währungskrise nach wie vor nicht saniert sind. Jetzt aber, da wieder Tilgungszahlungen Griechenlands anstehen und die erhoffte wirtschaftliche Belebung ausgeblieben ist, wird die Eurozone vermutlich in Kürze vor der gleichen Situation stehen wie schon vor zwei, vor vier und vor sechs Jahren. Nein, falsch: sogar vor einer seither verschärften Situation.
Der Internationale Währungsfonds, der ja eigentlich nicht zum Dramatisieren neigt, hat schon vor einem Jahr und gut begründet angekündigt, bei der Stabilisierung Griechenlands nicht mehr mitwirken zu können, wenn die Gläubigerstaaten in der EU einem weiteren substanziellen Schuldennachlass nicht zustimmen. Deren Regierungen wollen das aber kaum „schlucken“, weil sie unter dem Druck der Volksmeinung in ihren Ländern stehen, dass die Hilfe für Griechenland einmal ein Ende haben muss.
In diesem jahrelangen Prozess hat die griechische Bevölkerung mehr als ein Drittel ihres Lebensstandards eingebüßt, ist die Konjunktur nicht angesprungen und sind die Staatsschulden von ursprünglich (2009) 126 Prozent des Bruttoinlandsprodukts auf (2016) 183 Prozent gestiegen. Dazu kommt noch die höchste Belastung durch Flüchtlinge in Europa. Noch schlimmer als die Einbußen an Wirtschaftsleistung sind die krass ungerechte soziale Verteilung der Lasten, die hohe Arbeitslosigkeit (offiziell 25 Prozent) nicht nur der Jugend und die Auswanderung von Qualifizierten wegen Hoffnungslosigkeit. Eine taktische Fehlleistung der zu Hilfe gerufenen Retter EZB, IMF und EU – also die berüchtigte „Troika“ – war, das Ausmaß der Überschuldung mit viel zu optimistischen Annahmen herunterzuspielen. Damit wurden die Sanierungskonzepte für beide Seiten leichter annehmbar, stellten sich allerdings nach wenigen Monaten als unrealistisch heraus. Das konnte dann ungenügenden Anstrengungen der Griechen in die Schuhe geschoben werden und verschlimmerte die Situation, weil die Kreditkosten stiegen und das Sozialprodukt zurückging. Das hat verständlicherweise zur Radikalisierung der dortigen Bevölkerung bis an den Rand der Unregierbarkeit beigetragen, und auch nicht zur Bildung von Vertrauen in den anderen EU-Staaten.
Aber warum konnte Europa einem vergleichsweise kleinen Mitgliedsland nicht helfen? Um die unverantwortlich aufgeblähten öffentlichen Schulden Griechenlands komfortabel tragbar zu machen, als dies 2010 erkannt wurde, hätte etwa ein halbes Prozent des BIPs der EU genügt. Gegen einen so großzügigen Ausweg sprachen echte Bedenken: Im Fall von Zahlungsschwierigkeiten eines Mitgliedslandes haben die Partner keine Verpflichtung, einzuspringen (No-bail-out-Klausel). Leichtsinniges Schuldenmachen darf nicht ermutigt werden. Umgekehrt müssten allerdings auch Kreditgeber bei hohen Risikozuschlägen auf die Zinsen ihren Teil des Schadens tragen, wenn die Sache schiefgeht. Politisch war die Situation 2010 sehr ungünstig, weil nahezu alle anderen Mitglieder der Währungsunion 2009 selbst hohe Staatsschulden aufgenommen hatten, um die Rezession zu bekämpfen.
Nun könnte man argumentieren, die Europäische Zentralbank riskiere derzeit ein noch nie so niedrig gewesenes Niveau der Leitzinsen, das eher unter als über null liegt. Dadurch mache sie die Schulden leichter tragbar, besonders auch für hoch verschuldete Staaten. Natürlich muss bewusst sein, dass sich die Geldpolitik nicht nur um die Schuldner kümmern darf. Ein deutsches Versicherungsunternehmen errechnete, dass es billiger käme, für seine beachtlichen Bargeldbestände einen geeigneten Lagerraum zu mieten, statt sie in eine Bank einzulegen und Negativzinsen und Spesen zu zahlen.
Volkswirtschaftlich gesehen ist besonders bedenklich, dass unglaublich billiges Geld heutzutage keine langfristigen Investoren findet. Die Staaten wollen und müssen sparen, um ihre Schulden abzubauen. Die Unternehmen halten Liquidität, obwohl es ihre Aufgabe wäre, zu investieren. Auch die Privathaushalte zeigen im Durchschnitt wenig Ausgabenfreudigkeit. Die unsichere Wirtschaftslage mahnt zur Vorsicht. Das Ganze führt unweigerlich zu Höhenflügen von Aktien und von Immobilienanlagen bei zunehmender Aufblähung mit heißer Luft.
Die demnächst anstehende nächste Phase der Griechenland-Krise findet noch immer keine günstigeren Rahmenbedingungen vor. Nächtelange Uneinigkeit, Schielen auf den nächsten Wahltermin zu Hause und die radikaler werdende Stimmung in der Bevölkerung (Deutschland! Frankreich!) sind nicht gut für großzügige und weitsichtige Lösungen, weder für die Intensivstation Griechenland noch für den Pflegefall Euro.
Es mag beruhigen, wenn unser Wirtschaftsminister vor weiterem Schuldenmachen unseres hoch verschuldeten Staatswesens warnt. Überhöhte Staatsschulden sind nicht nur, wie Griechenland zeigt, gefährlich und Kennzeichen eines ineffizienten Staates, sondern auch unsozial, weil sie von Steuerzahlern zu Vermögensbesitzern umverteilen.
Aber mit dem allzu simplen Hinweis, dass Staatsschulden die nächste Generation belasten, hat er nicht ganz recht. Schulden haben immer zwei Seiten: Nicht nur die Verpflichtungen, auch die Forderungen werden vererbt. Ob das bedenklich ist, hängt im Wesentlichen von zwei Umständen ab:
- Tilgungszahlungen und Zinsen kommen der nächsten Generation der hiesigen Steuerzahler nicht zugute, wenn die Inhaber der Staatsanleihen im Ausland leben. Das trifft für die Gläubiger Österreichs überwiegend zu.
- Noch entscheidender: Ob zusätzliche Schulden vertretbar sind, hängt davon ab, was damit finanziert wurde. Verbrauchsausgaben fallen nicht unter die wünschenswerten Verwendungen, wohl aber Investitionen, die künftig Erträge abwerfen.
Im Grunde ist das Investitionsprogramm, das Juncker initiiert hat, richtig: Die Europäische Investitionsbank und der EFSI (Europäischer Fonds für strategische Investitionen) finanzieren Projekte im Ausmaß von 100 Milliarden Euro pro Jahr für die gesamte EU, also etwa ein halbes Prozent des BIPs. Das ist freilich viel zu wenig. Die nächste Generation der Steuerzahler könnte einmal die Frage stellen, warum nicht mehr in die Ertragskraft der Volkswirtschaften investiert wurde, als es epochal billigen Kredit gab und gleichzeitig sinnvolle Verwendungen.
Sinnvoll? Natürlich nicht, wenn man fragt: Wo gibt es noch ein Gebirge ohne Tunnel? Fehlen noch irgendwo Bauten, die uns für die nächste Olympiade qualifizieren? Aber es muss nicht mühsam nach Umwegrentabilität gesucht werden. Warum haben wir viel zu wenige gut ausgestattete Ganztagsschulen? Warum erreicht Österreich den angestrebten Aufwand für Forschung nicht, obwohl wir begeisternde Forschungsprojekte hätten? Warum müssen unsere Universitäten bis zu neun Zehntel der Maturanten bei der Aufnahme „hinausprüfen“, weil die Fakultät unter Mangel an Studienplätzen und das Land gleichzeitig unter Ärztemangel leidet?

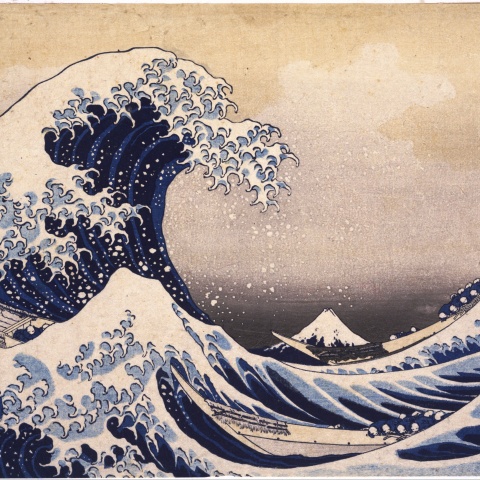











Kommentare