
Wenn das Fremde zum Feind erklärt wird
Auch in der Politik kann die fehlende Einheit zum ideologischen Ausgangspunkt werden. Eine Einheit wird imaginiert, politisch verpackt und mit Gefühlen angereichert. Im Mittelpunkt steht ein Volk, eine Heimat oder die Nation. Auch eine klassenlose Gesellschaft wurde in der Vergangenheit zur Trägerin einer imaginierten Einheit. Um ein „Eigenes“ zu erzeugen, braucht es die Abgrenzung zu einem „Fremden“. Das Fremde wird zum Feind erklärt. Die Existenz eines Feindes stärkt den inneren Zusammenhalt und verwischt die Differenzen. Schon Rosa Luxemburg hat festgestellt, dass nur die gemeinsame Ausrichtung auf einen konkreten Feind die Revolution möglich machte, weil sie die Differenzen der vielen, mit völlig unterschiedlichen Intentionen agierenden Gruppen kurzfristig in den Hintergrund rückte.
Für Carl Schmitt – einen deutschen Staatsrechtler, der sich ab 1933 für das NS-Regime engagierte – war die Unterscheidung von Freund und Feind ein wesentlicher Kern des Politischen. 1927 schrieb er: „Politisches Denken und politischer Instinkt bewähren sich theoretisch und praktisch an der Fähigkeit, Freund und Feind zu unterscheiden. Die Höhepunkte der großen Politik sind zugleich die Augenblicke, in denen der Feind in konkreter Deutlichkeit erkannt wird. Der politische Feind braucht nicht moralisch böse, er braucht nicht ästhetisch hässlich zu sein. Er muss auch nicht als wirtschaftlicher Konkurrent auftreten und es kann sogar wirtschaftlich vorteilhaft sein, mit ihm Geschäfte zu machen. Politik kann nur existieren, wenn die Möglichkeit besteht, einen Feind zu erkennen. Staatliche Ordnung genießt dabei absolute Priorität vor der rechtlichen Ordnung. Konkret bedeutet dies: Zum Zweck der Sicherheit des Staates kann eine Verfassung gebrochen oder suspendiert werden.“
Politik kommt vor dem Recht. Kommt uns diese Aussage nicht bekannt vor?
Schmitt schrieb auch: „Jede wirkliche Demokratie beruht darauf, dass nicht nur Gleiches gleich, sondern, mit unvermeidlicher Konsequenz, das Nichtgleiche nicht gleich behandelt wird. Zur Demokratie gehört als notwendig erstens Homogenität und zweitens – nötigenfalls – die Ausscheidung oder Vernichtung des Heterogenen.“
Um die Homogenität im Inneren der Gesellschaft abzusichern, braucht es einen äußeren Feind und die Eliminierung abweichenden Verhaltens im Inneren. Das „Objekt a“ der Politik ist die Vorstellung einer imaginären gesellschaftlichen Einheit. Ihre Herstellung erfolgt im Rückgriff auf Begriffe, wie Volk, Nation, Rasse, klassenlose Gesellschaft. Der Feind im Inneren und Äußeren wird erkannt, benannt und bekämpft.
Es gibt auch andere Versuche, das „Objekt a“ in der Politik zu bestimmen. Liberale Demokratien gehen davon aus, dass in der Akzeptanz bestehender Differenzen zwischen den Individuen und den gesellschaftlichen Gruppen eine einheitsstiftende Funktion möglich ist. Unter der Devise, wir sind uns einig, unterschiedlich zu sein und verschiedene Zugänge zu politischen Fragen zu haben, entsteht die Notwendigkeit eines politischen Diskurses, der naturgemäß viel aufwändiger ist als das Regieren über ein Dekret oder eine Verordnung. Das mühevolle Austarieren unterschiedlicher Standpunkte, die Entwicklung einer wirkungsvollen Streitkultur und das Wissen, dass am Ende ein Kompromiss herauskommen und das Ausverhandelte ein Optimum sein wird, das unter dem Maximum liegt, verlangt eine politische Reife von Einzelpersonen und Gruppen, die nicht von vorneherein vorausgesetzt werden kann. Der Verzicht auf ein Maximum, sprich die totale Einheit, erzeugt ein schwaches Objekt a und konfrontiert uns wieder mit einem ursprünglichen Mangel. Daher ist die politische Wirksamkeit und Akzeptanz des rationalen Diskurses begrenzt, weil die Akzeptanz von Differenzen und die damit verbundene Chance, Unterschiedlichkeiten und Vielfalt zu erfassen und die damit erfahrene Komplexität gemeinsam zu reduzieren und in politische Ziele und Programme umzuwandeln, nur begrenzt mehrheitsfähig ist. Politische Strategien, die mit Bedrohungen und der Schaffung und Instrumentalisierung von Ängsten arbeiten, können deshalb wirksamer sein, weil sie das Objekt a imaginativ stärker aufladen.
Die Freund/Feind-Spaltung, die Carl Schmitt politisch nutzt, wiederholt die Freud’sche Urverdrängung. Um die verlorene Einheit wieder zu erlangen, wird ein Teil nach außen projiziert und als Bedrohung klassifiziert. Damit entsteht ein Feind im Außen, der bekämpft werden kann, und Homogenität im Inneren, die politisch nutzbar ist. Wenn jetzt noch eine Führerfigur hinzutritt, die anstelle des aufgegebenen Ich-Ideals eine Einheit zu verkörpern scheint, kann die Identifikation mit dem Führer zu einer Auflösung der Individualität führen, und das Aufgehen in der Masse die Folge sein.
Gustav Le Bon beschreibt in „Psychologie der Massen“ (1895) einen Menschen, der Gefahr läuft, in der Masse seine Kritikfähigkeit zu verlieren und sich vorwiegend affektiv zu verhalten. Le Bon zeigt auf, wie man Massen beeinflussen kann und wie anfällig sie für Schlagworte und geschickte Täuschungen sind. Mit seinen Analysen ist er in Zeiten von „alternativen Wahrheiten“ und „fake news“ auf der Höhe unserer Zeit. Vilfrido Pareto entwickelte die Theorie vom Kreislauf der Eliten und Gaetano Mosca wies darauf hin, dass eine herrschende Klasse eine permanente Erscheinung der Geschichte ist. All diese Erkenntnisse lassen die Versuche erkennen, mit der aus der Urverdrängung entstandenen Spaltung umzugehen: sie zu verdrängen, zuzudecken, Teile von ihr nach außen zu verschieben und dort zu bekämpfen oder auch, sie polit-strategisch zu nutzen, sie mit Bedrohungen aufzuladen, Ängste zu erzeugen und damit das Wahlverhalten zu beeinflussen. Die einzige Alternative dazu ist das mühsame Geschäft eines politischen Diskurses, der die Differenzen der Menschen mit ihren unterschiedlichen Zielen und Wertvorstellungen als positiv erkennt und die Arbeit auf sich nimmt, politisch-inhaltliche Kompromisse auszuhandeln – im Wissen, dass sie für viele Bürger unbefriedigend sein werden und trotzdem das Beste sind, was wir erreichen können.












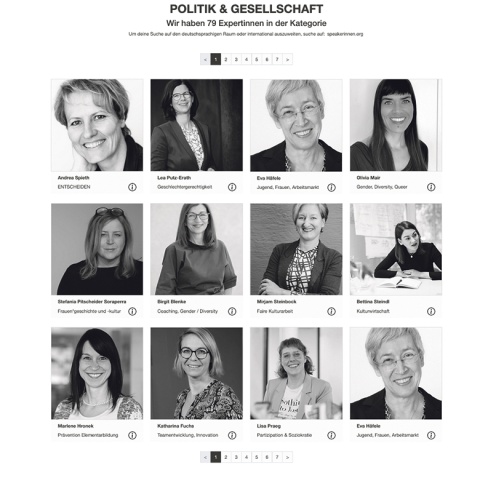

Kommentare