
Das Museum und sein Potenzial
November 2023
Auf dem Weg in die Zukunft – aber warum mit dem Kopf im Sand?
Ein Gespräch zwischen dem ehemaligen Leiter der Museumsakademie Gottfried Fliedl und dem Historiker Peter Melichar anlässlich des 34. Österreichischen Museumstages, der 2023 in Vorarlberg unter dem Titel „Mensch – Museum! Gestärkt in Richtung Zukunft“ vom 11. bis zum 14 . Oktober in Bregenz, Dornbirn und Hohenems stattfindet.
Peter Melichar: Du beschäftigst Dich intensiv mit Museen und ihrer Geschichte. Warum gibt es sie eigentlich, wer hat sie warum erfunden?
Gottfried Fliedl: „Erfunden“ wie das Automobil oder die Sachertorte hat das Museum niemand. So wie wir heute Museen verstehen und betreiben ist das Museum eine Institution, die in der Aufklärung und der bürgerlichen, genauer gesagt, der Französischen Revolution, entstanden ist. Museen haben mit Säkularisierung zu tun, mit der Notwendigkeit, innerweltliche, also geschichtliche Grundlegungen des gesellschaftlichen Zusammenhalts zu finden. Sie haben aber auch mit einer von der Industriellen Revolution vorangetriebenen und sich beschleunigenden Umwälzung so gut wie aller Lebensverhältnisse zu tun. Diese Transformation wurde als bedrohlich erfahren und es entstanden Gegenbewegungen. Dabei ging es um das Bewahren und Erinnern. Die Denkmalpflege rettet und erhält das „unbewegliche“, das Museum das „bewegliche“ Gut und die Geschichtswissenschaften etablieren sich als Gedächtnisinstanz.
Es ist undurchschaubar, nach welchen Gesichtspunkten eigentlich die Themen eines Museumstages festgelegt werden. Oder auch die Formulierung eines Themas – was soll zum Beispiel „Mensch – Museum! Gestärkt in Richtung Zukunft“. Soll „der Mensch“ gestärkt werden …
Wohl kaum! Andreas Rudigier wollte, dass es um die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geht …
…und davon ist das Stichwort Resilienz geblieben. Resilienz gegen die Krisen der Gegenwart. Also wird ein Zukunftsforscher eingeladen, Mitglied des Vorstands der Schweizerischen Gesellschaft für „Positive Psychologie“. Und dann geht es, wie das Programm in Blockbuchstaben ankündigt, ums TUN in mehreren workshops …
Um „initiatische Schwertarbeit“ und „Waldaudienz“…
Ja, es ist leicht, sich über das Programm lustig zu machen. Der Schwertkämpfer wird übrigens als Polizist und ehemaliges Mitglied des Einsatzkommandos Cobra vorgestellt, die anderen LeiterInnen der Workshops, die auf die Zukunftsbewältigung vorbereiten sollen und einen mit 24 Charakterstärken und sechs Tugenden beglücken, kommen teils aus der Wirtschaft, haben aber alle eine irgendwelche Coaching- und Supervisoren-Ausbildungen und sind dem vermeintlich „Positiven“ verpflichtet.
Was wirklich gespenstisch ist: die Wahl des Begriffs Resilienz. Resilienz bedeutet Anpassungsfähigkeit. Anpassung an Krisen, Traumata, Probleme und Veränderungen. Anpassung aber heißt: was Resilienz auslöst, soll nicht verändert werden. Sondern ich soll mich verändern, optimieren, anpassen also etwa an organisatorische Defizite, an mangelnde Kompetenz der Leitung, unzulängliche Bezahlung, schlechte Rahmenbedingungen. Wenn der Leiter des Technischen Museums seinen Mitarbeiterinnen die erwünschte Gehaltserhöhung nicht gewährt und diese dagegen zu kämpfen versuchen, wird ihnen dann am Museumstag gesagt: seid resilient?! Wirklich?
Was nicht gesagt wird: Wogegen sollte das Personal eigentlich resilient sein? Es wird von „Krisen“ geredet, aber es findet keine Analyse statt, wo es in den Museen denn kriselt. Daher wird auch keine Debatte darüber geführt. Sie dürfte unerwünscht sein, denn gerade die innerinstitutionellen Störungen betreffen ja die Führungskräfte und Eigentümer.
Du meinst die paternalistischen Leitungsstrukturen, den hierarchischen, autoritären Führungsstil, zuweilen als „flache Hierarchie“ getarnt, ungenügende Bezahlung und unbefriedigende Arbeitsverhältnisse gerade am unteren Ende der Hierarchie. Klar, dass die Lösung dieser Probleme unter dem Begriff Resilienz denen zugemutet wird, die nichts ändern können, sondern die Missstände nur ertragen müssen. Das Konzept des Museumstages setzt auf (Selbst)Optimierung der Einzelnen und verweigert sich der tatsächlichen Auseinandersetzung, dem Bearbeiten der Probleme und dem, wo es nötig ist, Widerstand gegen unbefriedigende Verhältnisse.
Nicht unwichtig auch: Ein dominantes Schlagwort ist „die Zukunft“. Dazu fällt mir nur ein, sicher ist, dass die Museen eine Vergangenheit haben, ob sie aber eine Zukunft haben und welche, das ist ganz und gar ungewiss.
Ja. Der Museologe Krszystof Pomian hat vor zwei Jahren den Museen den Untergang vorhergesagt: Die Coronakrise und die Klimakrise würden sie nicht überstehen. Was die Coronakrise betrifft, hat er jedenfalls nicht recht behalten. Eine andere Frage ist, ob Museen Zukunft mitgestalten, ob sie das wollen und ob sie das können.
Was ist denn aus den Ideen der Aufklärung und dem damals entstandenen Modell geworden?
Einerseits ist das Museum sehr anschmiegsam, kann sich an Trends und Moden gut anpassen. Da gabs das Museum 2.0, dann das partizipative Museum, jetzt die Digitalisierung und es wird nicht lange dauern, da wird es das KI-Museum als nächste Welle geben. Aber man müsste das Museum auch an seinen ursprünglichen Zielen messen: Zu Beginn des 19. Jahrhundert war es diskursiv, bildend und sozialisierend, politisch als Instanz der sich auch im und durchs Museum bildenden res publica. Doch oft frage ich: Ist dieses Ideal heute noch funktionstüchtig? Haben Museen noch eine Ahnung von ihrem Potential? Auf den Museumstagen ist davon wenig zu spüren, obwohl 2022 in Graz die Bemühung, auf die Klimakrise zu reagieren, authentisch wirkte. Aber trotz aller Bemühungen ist der Museumstag eher eine Zusammenkunft des Wohlfühlens und des Kennenlernens und sich wieder Treffens. Es geht um wechselseitige Anerkennung, um Vergabe von Preisen und Gütesiegeln. Warum auch nicht. Aber um die Verhandlung der tatsächlichen Probleme geht es nicht.
Was sind denn die wichtigsten Probleme? Um beim Personal, um das es ja gehen sollte, anzufangen: Stimmt der Eindruck, dass das Museum ein Schwamm ist, der jene Geisteswissenschaftler, die weder in der Wissenschaft noch in Bibliotheken und im Schuldienst unterkommen, aufsaugt? Welche Berufe – von Restauratoren abgesehen – braucht ein kleines, ein mittleres, ein großes Museum überhaupt? Gibt es dafür Ausbildungen und wo? Immer öfter sieht man, dass externe Kuratoren oder „Prozessbegleiter“ beauftragt werden. Selbst Inventarisierungen werden ausverlagert an Hilfskräfte, die die Objekte nie zu sehen bekommen, da werden einfach nur alte Inventare abgetippt.
Selbst die Kernkompetenz des Museums, das Ausstellen, wird teilweise, manchmal sogar nahezu ganz, an einschlägige Firmen delegiert. Architekten, Grafiker, Infografiker, Szenografen übernehmen nicht nur die Gestaltung, sondern oft auch die Art und Weise des Erzählens. Es entwickelt sich eine Arbeitsteilung zwischen hochspezialisierten Fachkräften. Selbst am Programm des Museumstages war eine Agentur beteiligt. Was meiner Meinung nach dramatisch im Schwinden ist, ist ein Gefühl für die unverwechselbaren Qualitäten, die Museen haben und damit für die Möglichkeiten, den Eigensinn der Institution zu entwickeln. Müsste ich die schlimmste aller Krisen identifizieren, dann wäre es: Phantasielosigkeit. Und das als Effekt einer großen Ahnungslosigkeit dessen, was ein Museum ist und sein könnte.
Das drückt sich dann auch in den Themen der Ausstellungen aus. Was wird geboten? Krippenausstellungen vor Weihnachten ohne Hinweise auf die Abgründe der Heiligen Familie, Architekturausstellungen, die jede kritische Distanz vermissen lassen und die Bauwirtschaft ausblenden, Porträt- und Gruppenfotos aus dem Bregenzerwald, ohne die Geschichte der Talschaft auf ihre Probleme hin zu befragen. Überhaupt werden brisante Themen, wie Religion, Verkehr, Landwirtschaft, Grund und Boden, Migration vermieden. Völlig zu Recht macht man sich dann Sorgen über Akzeptanz und Relevanz von Museen, die schließlich dem Steuerzahler Geld kosten und beauftragt eine Erforschung der Nichtbesucher mit dem Ergebnis, dass man nun weiß: ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung geht nie ins Museum, weil es sie nicht interessiert. Wie könnte man der von Dir diagnostizierten Ahnungs- und Phantasielosigkeit entkommen? Wie gegensteuern?
Die Nichtbesucherforschung ignoriert zwei Dinge. Ersten weiß man seit etwa dreißig, vierzig Jahren sehr genau, wer warum ins Museum geht und wer nicht. Das Museum ist ein Ort beachtlicher sozialer Distinktion und damit von Ausgrenzung. Museumsbesucher kommen weit überproportional aus gebildeten Schichten. Der zweite Aspekt, der vergessen wird, ist die Frage der kulturellen Hegemonie. Museen sind nicht nur hinsichtlich ihrer Besucher kulturell elitär, sie sind es auch, weil es kleine Eliten sind, die die Werte festlegen, die einerseits partikulare sind, andererseits allgemein gültig sein sollen. Inzwischen wird das Schwinden des „klassischen“ Publikums beklagt (nicht nur von Museen), des kulturaffinen Bürgertums. Und tatsächlich ist etwas in Bewegung geraten. Der Kunstkanon etwa wurde in den 70er-Jahren erschüttert, als man entdeckte, dass es auch bedeutende Künstlerinnen gibt, ausgeschlossen aus der musealen Kunstgeschichte. Dann wurde allmählich der Eurozentrismus des Museums entdeckt und schließlich die zugrundeliegende Gewaltförmigkeit, als der Raubbau des Kolonialismus infolge der Planungen zum Humboldt-Forum in Berlin zum medialen Aufreger wurde. Jetzt nimmt man zur Kenntnis: Kein British Museum ohne von Sklaven betriebene Zuckerplantagen in Jamaika.
Schon wieder ein Thema, bei denen Museen den Kopf in den Sand stecken…
…nicht ganz. In Berlin sind die Museen schwer unter Druck geraten durch die öffentlichen Debatten, und es gibt in zum Beispiel in den ethnologischen Abteilungen des Humboldt-Forum reichlich Information und Auseinandersetzung. Aber es gibt zum Beispiel in Deutschland kein Restitutionsgesetz.
Aber zurück zu meiner Frage – wie gegensteuern…
Ich scheue mich, zu antworten, weil es im Grunde um eine neue Ethik und Politik des Museums ginge. Und so etwas kann nur aus einem kollektiven Bedürfnis entstehen. Und da bin ich nicht optimistisch. Was für eine Vielfalt an Theaterformen gibt es? Wie sehr können Kinofilme aufregen? Obwohl der Tod des Theaters und das Sterben des Kinos schon oft behauptet wurde, erstaunen diese Kulturinstitutionen immer wieder mit ihrer Innovationfähigkeit und politischer Wachheit. Aber wo gibt es diese lebendige Auseinandersetzung mit den brennenden Fragen der res publica beim Museum?
Aufzeichnung: Redaktion





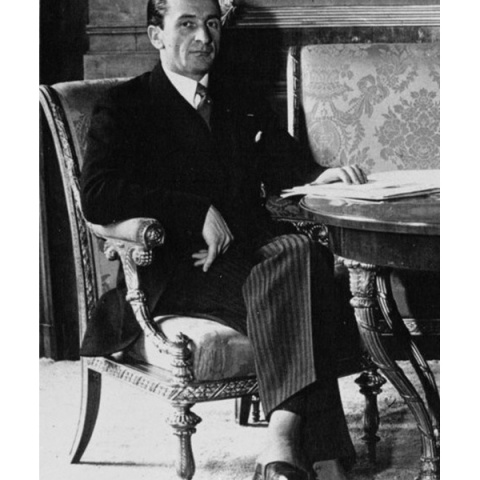






Kommentare