
„Ich bin ständig in der Ukraine“
Gerald A. Matt traf Kaiserenkel Karl Habsburg-Lothringen (64) zu einem Gespräch. Karl Habsburg-Lothringen ist Medienunternehmer, Land- und Forstwirt und ehemaliger österreichischer Politiker für die österreichische Volkspartei im Europäischen Parlament von 1996 bis 1999.
Sie sind der älteste Sohn von Otto von Habsburg. Und gäbe es die Monarchie in Österreich noch, wären sie Österreichs Kaiser.
Ich bin der Familienchef in meiner Familie, damit bin ich sozusagen in der Position. Aber das, ‚was wäre wenn‘, sind immer so Fragen, die wenig Sinn machen.
Sie sind Medienkonsulent und auch Mitteigentümer von Fernsehen und Radioanstalten.
Ja, das ist richtig. Radio war immer eine große Passion.
Da spielt auch ein Radiosender eine große Rolle, nämlich in der Ukraine, den sie schon vor dem russischen Überfall aufbauten. Was hat Sie da angetrieben?
Ja, lang vorher, im Jahr 2007. Ich war in der Ukraine auch aus familiären Gründen oder vielmehr auch aus historischen Gründen. Die Westukraine gehörte ja zur K&K-Monarchie. Die Ukraine ist ein sehr großes Land mit riesigen Ressourcen, auch ökonomisch. Da war es interessant für mich, relativ früh im Radiobereich mitzuwirken; wobei die Radiopräsenz sich einige Male änderte, das erste Mal 2014, als die Russen die Krim einnahmen und den Donbass überfielen. Mit dem Generalüberfall auf die Ukraine im Februar 2022 durch Russland hat das Radio eine ganz andere Dimension, eine andere Wichtigkeit für die Ukraine gewonnen.
Wie würden Sie die Stimmung jetzt in der Ukraine beschreiben, Ausnahmezustand oder auch Alltag?
Sehr ambivalent. Wenn man heute in Kiew unterwegs ist, hat man das Gefühl, dass eigentlich alles völlig normal ist. Dann kommt der Luftalarm. Und die meisten Leute reagieren nicht. Wenn man sich bei jedem Luftalarm in den Keller begeben würde, würde man nur zwischen Keller und Arbeitsplatz hin und her laufen.
Fahren Sie noch hin und her?
Ich bin ständig in der Ukraine, mindestens alle sechs Wochen.
Haben Sie keine Angst?
Nein, absolut nicht.
Bleiben Sie bei Luftalarm auch im Büro?
In Kiew, natürlich, ja. In Charkiv ist es natürlich ganz anders, weil die Alarme wesentlich häufiger sind und weil man in Frontnähe ist und die Artillerie hört. Da sind viele Menschen auch aus der Stadt geflohen. Wir hatten dort ein Projekt zur Unterstützung der Schulen, die in die U-Bahn-Stationen verlegt wurden. Und da konnte gerade das Radio auch beim Unterricht helfen.
Was ist Ihrer Meinung nach zurzeit das größte Problem der Ukraine? Wie schätzen Sie bislang die europäische Reaktion auf den Krieg und die europäische Haltung ein?
Einige Länder haben richtig und sehr gut reagiert, andere absolut nicht. Das Hauptproblem momentan ist, dass wir übersättigt sind von dem, was wir dort sehen und dass – je weiter man nach Westen kommt –, das Interesse abflaut. Vergessen wir aber nicht, dass wir in Wien näher an Ushkodot als an Bregenz sind. Und Polen ist ganz nah dran. Die Polen haben die Erfahrungen der Sowjetzeit und wissen, dass die Ukraine nur der erste russische Schritt ist. Und deswegen sagen sie immer, muss man Russland jetzt stoppen. Im Westen nimmt man das alles viel zu locker. Da denken viele, in der Ukraine geht’s halt weiter und schauen wir doch mal, was in Transnistrien passiert oder in den baltischen Staaten. Dann gibt es diese Gutmenschen, die glauben, dass man durch Appeasement irgendwas erreichen kann. Wenn Scholz etwa meint: Wenn man dem Putin nur genügend gibt, dann wird er dann schon Ruhe geben und zufrieden sein. Das sind die Menschen, die Geschichte weder gelesen noch die Lektion des zweiten Weltkrieges verstanden haben. Da treffen sich die Nationalen mit den Kommunisten, von Kickl bis Wagenknecht, all diese Putin-Verehrer.
Sehen Sie das als größte Gefahr für die Unterstützung und das Überleben der Ukraine?
Selbstverständlich. Wir wissen ja nicht, was in Amerika tatsächlich passieren wird, nicht, wie Trump reagieren wird. Das kann in jede Richtung gehen.
Es gibt eine bekannte Rede, in der Ihr Vater vor Putin gewarnt hat. Das ist geraume Zeit her, 2003.
Mein Vater war ein Visionär, aber er war auch ein Pragmatiker. Er hat sich pragmatisch die Karriere Putins angesehen und hat gesagt, da kommt nichts wirklich Gutes heraus. Genauso hatte er zu einem sehr frühen Zeitpunkt ‚Mein Kampf‘ gelesen und war deswegen auch zutiefst gegen die Nazis eingestellt.
Es gab einen Ermordungsaufruf von Rudolf Hess, dem Stellvertreter Hitlers, gegen ihren Vater, der ein engagierter Gegner Hitlers war. Wie würde er heute Parteien sehen, mit antieuropäischer Haltung, Nähe zu Rechtsradikalen und autoritärer Einstellung?
Er würde sich bestätigt fühlen. Er hat immer betont, dass zwei Generationen, die keinen Krieg mehr erlebt haben, die Gefahr des Nationalismus, der ja immer zur Entsetzlichkeit von Kriegen hinführt, nicht sehen. Und das erleben wir momentan.
Sie waren ein persönlicher Freund von Alexej Nawalny. Wo und wie haben Sie ihn kennengelernt und wie sehen Sie sein Schicksal in Bezug auf Putins Russland?
Ich habe ihn erst sehr spät, nach seiner Vergiftung kennengelernt, als er in Berlin zur Behandlung war. Ich habe mit ihm relativ viel Zeit verbracht und lange Diskussionen geführt, bevor er nach Russland zurückging, wo er verhaftet und letztendlich dann auch ermordet wurde. Er war überzeugt, dass er zurückkehren muss. Sehr viele Leute haben ihm abgeraten und gesagt, du wirst sterben. Er sagte: Ich weiß.
Wird sein Tod etwas bewirken?
Ja, davon bin völlig überzeugt. Seine Frau, Julia, und seine Kinder kümmern sich sehr um seine ideologische Verlassenschaft. Auch wenn Putin die Lufthoheit über die Information mit allen Mitteln zu halten versucht. Nawalny hatte Möglichkeiten, auch über soziale Medien innerhalb Russlands Menschen zu erreichen. Wenn er etwa Tweets abgesetzt hat, dann hatte er innerhalb einer Stunde ungefähr eine Million Likes. Also ich glaube schon, dass das nachhaltig wirkt. Ein Märtyrertod entfaltet immer seine Wirkung.
Wie Ihr Vater sind sie ein leidenschaftlicher Europäer. Sie waren viele, viele Jahre Präsident der Pan-Europa-Bewegung Österreich und im Vorstand des Präsidiums der Pan-Europa-Union. Glauben Sie noch an ein geeintes Europa?
Ja. Die Europäische Gemeinschaft, die Europäische Union ist das größte Friedensprojekt, das es jemals auf dieser Welt gegeben hat.
Aber die Sicherheit wurde nach außen, an die Vereinigten Staaten, delegiert.
Das ist die große Schwäche der Europäischen Union, dass sie nicht eine funktionierende Außen- und Sicherheitspolitik, kein Sicherheitskonzept hat. Wir brauchen auch die berühmte Telefonnummer, wo jemand anrufen kann, wenn er mit Europa sprechen will. Das gibt es nicht.
Wo sehen Sie die größten Gefahren für Europa zurzeit?
Unmittelbar ist das natürlich der Krieg in der Ukraine und die ihm zugrundeliegenden Strategien Russlands. Das ist auch eine Art Weckruf für Europa.
Für ein Europa in der Krise, dessen Probleme von Migration über Inflation, Nationalismus und Sicherheit reichen, ein Europa auch im wirtschaftlichen Niedergang?
Sie haben jetzt die ganzen Schwierigkeiten aufgezählt. Aber ich bin nach wie vor ein Europa-Optimist. Wir sind nicht vor dem Absturz. Wir haben nach wie vor eine ungeheure Wirtschaftskraft und politische Strukturen, die funktionieren. Natürlich leiden wir auch an Überbürokratisierung und unsinnigen Reglementierungen. Aber wir haben die Kraft, uns am eigenen Schopf zu packen und uns aus diesen Krisensituationen zu befreien. Was viele als Schwäche im Wettkampf mit den USA und China sehen, unsere sozialen und ökologischen Auflagen, ja unsere Werte, müssen neu kalibriert werden. Das sind auch unsere Stärken.
Wenn Sie eine der großen Stärken Europas nennen würden, welche wäre das?
Für mich ist es die Diversität Europas, die Tatsache, dass wir keine Monogesellschaft sind, weder im wirtschaftlichen Bereich noch im politischen Bereich noch im Sicherheitsbereich. Bei allen Unterschieden Europa ist der größte Cluster von demokratischen Staaten auf der Welt. Marktwirtschaft, Rechtsstaatlichkeit, Rechtssicherheit, das sind unsere Stärken, die bereits im Wiener Kongress grundgelegt wurden.
Sie haben einen Hilfskonvoi nach Vilnius damals organisiert. Sie haben auch als es um Dubrovnik ging, sich im Jugoslawien-Konflikt engagiert. Woher diese besondere Leidenschaft für Ost- und Südosteuropa?
Ich glaube als Europäer auch an das Konzept Mitteleuropa und auch an Ost-Südosteuropa. Dazu gehört auch die Erweiterung der Europäischen Union. Mir geht es dabei um die ganzen südosteuropäischen Staaten, Serbien, Montenegro, Albanien, etc. Dann gibt es für mich Länder, die auf unserem Radarschirm fehlen und die zutiefst europäisch sind, etwa Georgien. Zum Konzept Mitteleuropa gehört auch das Miteinander verschiedenster Kulturen. Da denke ich auch an das erste Volksgruppenrecht. Das war der Mährische Ausgleich, Rechtsnormen, die auch dieser Diversität tatsächlich gerecht geworden sind.
Eine persönliche Frage: In Ihren ersten Lebensjahren bestand gegen die Familie ein Einreiseverbot nach Österreich. Wie haben Sie das damals empfunden?
Man hat das eigentlich als gegeben hingenommen und gesagt, der Begriff ‚immerwährend‘ gilt nur in der Religion und sonst nicht, also irgendwann kann man auch wieder zurückkehren. Und ab dem Jahr 68 durften wir ja auch einreisen.
Ihr Vater war ein sehr politischer Mensch, aber natürlich auch eine sehr starke Persönlichkeit. Wie kommt man mit einem solchen Vater zurecht?
Ich glaube, das Verhältnis hätte nicht besser sein können. Mein Vater war unglaublich tolerant und hat immer gesagt, die beste Kindererziehung ist, die Interessen der Kinder zu fördern. Natürlich waren wir nicht immer einer Meinung. Wir waren gleichzeitig im Europäischen Parlament, saßen sogar nebeneinander. Aber wir haben ja zwei verschiedene Länder – er Deutschland, ich Österreich – vertreten. Als uns ein Journalist fragte, ob wir wissen, wie oft wir miteinander abgestimmt hätten, glaubten wir beide, dass dies über 90 Prozent liege. Doch es waren nur 74 Prozent. Das hat uns sehr amüsiert.
Ihr Vater war Abgeordneter für die CSU, Ihre Schwester für Schweden tätig, Ihr Bruder Botschafter für Ungarn in Paris, eine andere Schwester georgische Botschafterin in Berlin. Bei all dieser Internationalität, gibt es da so etwas wie Heimat?
Heimat ist ja ein Bauchgefühl. Als überzeugter Europäer fühle ich mich überall in Europa zu Hause. Meine emotionale Heimat ist aber Mitteleuropa, Österreich und vor allem Salzburg, wo ich lange Zeit gelebt habe. Während der Patriot dieses Bauchgefühl hat, etwas wunderschönes, das nicht an eine Nation oder eine Grenze gebunden ist, glaubt der Nationalist: ‚Ich bin besser und der andere ist deswegen schlechter.‘ Von diesem Unsinn haben wir ja leider ein Comeback im Moment.
Herr Habsburg Lothringen, herzlichen Dank für das Gespräch!
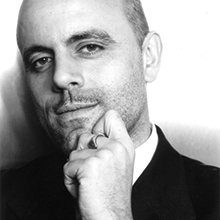









Kommentare