
„Bildungsbürgerliche Arroganz“
Kurt Palm stellte unlängst sein neuestes Buch vor, den Roman „Trockenes Feld“, eine, wie „Die Zeit“ schrieb, schonungslose Erzählung der Flucht und Lebensgeschichte seiner Eltern. Palm engagierte sich in der Studentenzeit beim Kommunistischen Studentenverband und sieht sich heute noch als Marxist. Seit 1982 arbeitet Palm als Regisseur, Autor und Volksbildner. 1989 gründete er in Wien die legendäre Theatergruppe „Sparverein Die Unzertrennlichen“, die 1999 wieder aufgelöst wurde. Von 1994 bis 1996 inszenierte er 24 Folgen der von Hermes Phettberg moderierten legendären „Phettbergs Nette Leit Show“. Gerald Matt traf die schillernde Persönlichkeit zu einem Gespräch.
Was hat Dich dazu bewegt, Deine Familiengeschichte aufzuzeichnen? War das auch eine Art Katharsis nach dem Tod Deiner Eltern?
Zum Teil sicher. Das Buch ist aber keine Abrechnung mit meinen Eltern. Es ist eher eine Art Versöhnung mit einer Geschichte, die sehr verschieden zu meiner Geschichte ist. Meine Eltern sind unter Umständen aufgewachsen, die weit entfernt sind von dem, wie ich aufgewachsen bin. Es gibt im Buch auch eine Gegenüberstellung des 21. Geburtstags meines Vaters und seines damaligen Lebens und meines 21. Geburtstags. Und da gibt es eigentlich keine Überschneidungen.
Gibt es für Dich so etwas wie die Gnade der späten Geburt?
Das hoffe ich nicht. Jeder hat seine Verantwortung.
Doch ein milder Blick zurück?
Ich halte weder etwas von Begriffen wie seniler Altersmilde oder verklärter Altersweisheit noch etwas von der verharmlosenden Jugendsünde. Allerdings sind die Sünden, die die Erwachsenen begehen, viel schlimmer als alle Sünden, die die Jugendlichen jemals begangen haben. Die Kriege und Verbrechen werden im Wesentlichen von älteren weißen Männern begangen. Dass ich das Buch erst jetzt geschrieben habe, hat weniger mit dem Tod der Eltern zu tun als damit, dass ich vor 10, 20 Jahren noch nicht das Werkzeug dazu hatte. Ich habe mich nie beschäftigt mit transgenerationalen Traumata – jener Traumata der Eltern- und Großeltern-Generation, die die Generation betreffen, der ich angehöre. Das literarisch zu verarbeiten, war ein unglaublich aufregender Prozess.
Ist es Dir schwergefallen, dieses Buch zu schreiben?
Nein, das Ganze war wie eine Abenteuerreise. Ich habe recherchiert und recherchiert und immer wieder Neues erfahren. Bislang habe ich mich in meinen Arbeiten ja mit Biografien von James Joyce, von Mozart und Adalbert Stifter beschäftigt. Ich wusste mehr über deren Familien als über meine eigene. Und irgendwann habe ich mir gedacht: Das kann nicht sein. Und ich wollte wissen: Woher kommen meine Eltern, woher meine Vorfahren, woher komme ich. Und am Ende des Tages kann ich sagen, dass die Biografien dieser einfachen Leute viel spannender sind als alles, was ich jemals über Mozart, Stifter oder Joyce geschrieben habe.
Du hast von umfangreichen Recherchen gesprochen – fact finding. Ist das Buch streng dokumentarisch, quasi der Wahrheit verpflichtet? Wie ist da das Verhältnis von Finden und Erfinden, von Wirklichkeit und Fiktion?
Da möchte ich den Regisseur Werner Herzog zitieren, der sagte: „Es gibt keine Wahrheit in der Erinnerung.“ Und wichtig ist mir da auch ein Satz von Louis Bagley, einem Autor, den ich sehr schätze: „Wir kommen der Wahrheit nie näher als in erfundenen Geschichten.“ Im Kern ist die Geschichte – sind die Geschichten –, die ich erzähle, immer wahr. Aber die Ausformung ist immer wieder auch sehr fiktionalisiert. Anders wäre es gar nicht möglich. Denn es gab sehr, sehr wenige Quellen. Die Alternative war, es bleiben zu lassen oder mich darauf zu besinnen, dass ich Autor bin und fiktionalisiere.
Der Blick auf die Elterngeneration war für viele Jahre, zumindest für unsere Generation, auch ein Blick auf Schuld.
Ja, auf jeden Fall, denn es ging mir ja darum, das einzuordnen, was mein Vater gemacht hat. Ich musste erfahren, dass mein Vater mit 18 quasi vom Schweinestall zur SS-Polizei zwangsrekrutiert wurde. Ich dachte immer, er wäre bei der Wehrmacht gewesen – schlimm genug. Er hat darüber nie gesprochen. Das war so tabu, wie es die Zeit der Flucht meiner Mutter und meines Vaters aus Kroatien war. Als mein Vater 1997 starb, habe ich eine Rede in der Kirche gehalten. Heute weiß ich, dass die Hälfte von dem, was ich sagte, schlichtweg nicht gestimmt hat. Und es ist niemand von den Verwandten gekommen, der gesagt hat: ‚So war das nicht.‘ Das galt auch für die Geschichte meiner Mutter. Ich wusste nicht, dass meine Mutter als 16-Jährige 1943 auf einem Pferdewagen flüchtete und 14 Monate ohne Ziel unterwegs war und durch Zufall in Oberösterreich strandete. Natürlich hat sie unterwegs immer wieder hart gearbeitet, um sich zu ernähren. Bei der Geschichte meines Vaters halfen mir Dokumente aus dem deutschen Bundesarchiv. Und ich habe jedes Mal gezittert, wenn Dokumente gekommen sind. Da ging es darum: Wann und wo war seine Einheit? Gab es zu dieser Zeit da ein Massaker in der Nähe, an dem die SS-Polizei beteiligt war? Das war mit einer großen Angst verbunden.
Ist Dein Blick in Deinem Buch auf Deine Eltern beziehungsweise auf Deinen Vater auch mit Vorwürfen verbunden?
Nein, überhaupt nicht. Zum einen gab es – ohne meinen Vater jetzt freisprechen zu wollen – keine Dokumente, die belegen würden, dass er bei einem Verbrechen dabei war. Zum anderen weiß ich, erlebte ich, dass mein Vater kein Nazi war. Er hat nie positiv über Hitler noch über den Krieg gesprochen. Als ich als Jugendlicher Kriegsfilme angeschaut habe, wurde er ernstlich böse.
Vieles an Deiner Familiengeschichte, vieles im Buch, ist dem Zufall geschuldet. Ist Schuld auch mit Zufall verbunden?
Ja und nein. Dennoch ist auch da die entscheidende Frage die nach der Verantwortung. Zufall entlässt nicht aus der Verantwortung. Als Autor war für mich entscheidend, alle Karten auf den Tisch zu legen, egal, was herauskommt. Ich habe auch über den Suizid meines Bruders geschrieben, weil ich überzeugt davon bin, dass sein Selbstmord mit der Fluchtgeschichte meiner Eltern zu tun hat – mit dieser Ungewissheit, ja Unsicherheit, nicht zu wissen, wo man eigentlich hingehört. Als meine Eltern letztendlich 1945 in Österreich angekommen sind, hatten sie alles verloren, waren besitzlos, recht- und staatenlos, ohne Arbeit und Wohnung. Als ich das Geburtenbuch vom Krankenhaus Vöcklabruck aus dem Jahr 1955 einsah, fiel ich aus allen Wolken. Da las ich, dass meine Eltern 1955 immer noch staatenlos waren und damit auch ich kein Österreicher war. Zuständig war immer noch Jugoslawien. Der Ort, aus dem meine Eltern stammen, lag im Norden Kroatiens und hieß Suhopolje, was auf Deutsch so viel heißt wie „trockenes Feld“. Daher auch der Buchtitel.
Jetzt eine grundsätzliche Frage zu Dir als Autor, als Künstler, als Theatermann, als Mann des Films. Wie und wann kamst Du zur Kunst?
In unserer Familie spielten ja Literatur oder Theater überhaupt keine Rolle. Als Jugendlicher suchte ich Vorbilder, die ich in literarischen Figuren wie Odysseus, Robinson Crusoe oder Lederstrumpf fand. Mir war schrecklich langweilig in den Ferien, und dann bin ich in die Bücherei gegangen im Gemeindeamt und habe mir die Bücher ausgeborgt. Ich ging in die Handelsakademie in Vöcklabruck, und Buchhaltung und Betriebswirtschaft langweilten mich zu Tode. Da waren Deutsch und Literatur ein Lichtblick. Dazu kam, dass ich und meine Freunde mit den gesellschaftlichen Verhältnissen – es war Anfang der 1970er-Jahre – überhaupt nicht zurechtkamen. Wir haben nach Alternativen gesucht und fanden die einerseits in der Politik, andererseits in der Musik und dann in der Literatur.
Gab es da Vorbilder?
Also ein großes Vorbild war Franz Kafka für mich. Und natürlich Bertolt Brecht – zwei Antipoden, auf den ersten Blick, auf den zweiten Blick gar nicht so weit voneinander entfernt. Und Marx und nochmals Marx.
Würdest du dich heute noch als Kommunist bezeichnen?
Ich bin marxistisch geprägt. Aber als Kommunist würde ich mich nicht bezeichnen, weil ich nicht mehr Mitglied der kommunistischen Partei bin. Aber Marx interessiert mich nach wie vor. Hier ist die große Frage: Wie kann man das integrieren in unsere Gegenwart und vor allem auch in die Kunst?
Kurt Palm, ein politischer Autor?
Auf jeden Fall. Ja.
Hat Kunst für Dich eine ethisch-moralische Verpflichtung?
Absolut. Aber ich bin weit vom Dogmatismus entfernt. Wichtig ist die Vielfalt.
Wie arbeitest Du? Wie kommst Du von der Idee dann zum Werk, wie ist die Genese eines Deiner Romane?
Das ist nicht so einfach zu beantworten. Ich arbeite meistens im Blindflug und höchstens auf Sicht.
Auch beim „Trockenen Feld“? Da ging es ja doch um Fakten und einen Plan.
Ja, dennoch geht es auch da um Fiktion, um Literatur.
Hat das Alter – oder nennen wir es die Erfahrung – Deinen Blick auf die Welt, Dein Schreiben verändert?
Meinen Blick auf die Welt eigentlich nicht. Ich war immer schon ein pessimistischer Optimist. Und die Wirklichkeit bestätigt mich eigentlich jeden Tag aufs Neue. Was mir auch blieb, ist der kritische Blick auf meine Arbeit.
Geht das so weit, dass Du, wenn du Dein Werk wieder liest, es am liebsten wieder umschreiben willst?
Nein, nein, nein. Was da steht, steht da. Da stehe ich auch dazu.
Du hast Dich selbst als Volksbildner bezeichnet.
Ja, so habe ich vor 25 Jahren meine sogenannten „Kochtheaterproduktionen“ gemacht, Events zu Brecht, zu Stifter, zu Joyce oder zu Kafka. Ich dachte mir, dass es schade ist, dass so wunderbare Autoren wie James Joyce so wenig gelesen werden. Und da ging es mir darum, das Lesen auch mit Lust zu verbinden, indem ich live auf der Bühne Speisen zubereitete, die im Ulysses vorkommen oder im Nachsommer von Stifter oder im Prozess von Kafka – und das Publikum dazu einzuladen, sich die Literatur dieser Autoren einzuverleiben. Da ging es nicht um trockene Pädagogik, sondern um Volksbildung im besten Sinn des Wortes. Unterhaltung und Bildung zu trennen, habe ich immer als bildungsbürgerliche Arroganz empfunden.
Du hast ja sehr viele, sehr unterschiedliche Dinge gemacht, bist in allen künstlerischen Genres – Film, Theater, Literatur – zu Hause. Wie hat sich das gegenseitig beeinflusst?
Der Grund dafür ist banal. Ich wusste von Anfang an – ich bin seit 1983 selbstständig –, dass ich von einer Sache allein nicht leben kann. Und ich habe einfach Dinge ausprobiert. Ist es möglich, über die Literatur zum Theater zu kommen? Und vom Theater zum Film und von dort wieder zur Literatur? Heute hat sich aber vieles verändert. So ist Theater für mich als „alter weißer Mann“ sehr schwierig geworden. Das sage ich jetzt nicht als negative Zuschreibung, sondern als Faktum. Viele der Debatten – wie zum Beispiel die Aneignungsverbote – sind, bei aller anfänglichen Berechtigung, totalitär und dogmatisch, ja kunstfeindlich geworden und völlig aus dem Ruder gelaufen. Und da sind Leute wie ich – in meinem Alter, in meiner geschlechtlichen Zuschreibung – besonders betroffen.
Letzte Frage, ganz kurz. Was ist geplant, was kommt als Nächstes?
Ein Roman mit dem Titel ‚Der Hang‘, erzählt aus zwei verschiedenen Perspektiven – einmal aus der Perspektive einer Frau in der Ich-Form, großes Risiko, und einmal aus der Perspektive einer Maus, die mit ihrer Kolonie in diesem Hang lebt und die sehr große Probleme hat, weil dieser Hang in Bewegung gerät und möglicherweise die Kolonie zerstört.
Danke für das Gespräch!
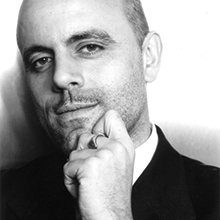









Kommentare