
Sr. Rosalia – Barmherzige Schwester vom heiligen Kreuz
2019 jährte sich nicht nur der Beginn des Zweiten Weltkrieges zum 80. Mal, sondern auch der Beginn
des ersten geplanten systematischen Massenmordes der NS-Diktatur.
Mit einem auf den 1. September 1939 rückdatierten Erlass nach Beginn des sog. Polenfeldzuges ermächtigte Adolf Hitler den Arzt Karl Brandt, Standeskollegen zu bestimmen, die bei erwachsenen Menschen mit Behinderungen dann den sog. Gnadentod verordnen konnten, wenn diese nach dem Stand der Wissenschaft als unheilbar krank galten. Damit wurde die Verbindung zwischen dem Zweiten Weltkrieg und dem Massenmord an Menschen mit Behinderungen offenbar. Daher sollte an sie 80 Jahre später als solche auch erinnert werden.
Zwischen 1939 und 1945 wurden in NS-Deutschland und in NS-Österreich zumindest 100.000 Menschen mit Behinderungen auf der Grundlage des Hitler-Erlasses ermordet – auch noch, als Hitler diesen wegen heftiger Proteste von christlichen Bischöfen und mutigen Bürgern im August 1941 in einer mündlichen Weisung an die NS-Verantwortlichen zurückzog. Die Getöteten dieses staatlichen Mordprogrammes kamen aus allen sozialen Schichten, aus allen Berufs- und Altersgruppen. Das wurde wiederum deutlich, als im Oktober 2019 die Kummenberggemeinden und im November 2019 die Stadt Hohenems Erinnerungszeichen für die ermordeten Menschen mit Behinderungen aus ihren Gemeinden setzten. In Hohenems war unter den Getöteten ein Ordensmitglied.
Sr. Rosalia, Kreuzschwester und Lehrerin
Sr. Rosalia trat im letzten Jahr des Ersten Weltkrieges in den Orden der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz ein. Acht Jahre später, am 27. April 1926, legte sie ihr erstes, am 27. April 1932 ihr ewiges Ordensgelübde ab. Zu diesem Zeitpunkt war sie schon vier Jahre Lehrerin an der Handelsschule des Instituts St. Josef in Feldkirch. Ende 1929 erkrankte sie erstmals so schwer, dass sie über das städtische Spital in die sog. Landesirrenanstalt Valduna in Rankweil eingewiesen wurde. Ende Januar 1930 wurde sie als geheilt entlassen. Sie nahm ihre Arbeit als Handelsschullehrerin in Feldkirch wieder auf. In der Folge unterrichtete sie im Marienheim in Bludenz. Dort war seit 1901 ein Kinderheim für Arbeiterfamilien der Textilfirma Getzner und eine Haushaltungsschule für Mädchen untergebracht, die von den Kreuzschwestern betrieben wurden.
Im April 1934 erkrankte Sr. Rosalia ein weiteres Mal an sog. Wahnvorstellungen und wurde über diverse Stationen auf Dauer in die Valduna eingewiesen. Dort blieb sie bis zu ihrer Deportation in eine Tötungsanstalt im März 1941. In diesen sieben Jahren bekam sie regelmäßig Besuch von ihren Ordensschwestern und ihrer Familie aus Hohenems. Noch am 19. Februar 1941 bemühten sich ihr Bruder und ihre Mutter um eine Entlassung von Sr. Rosalia in die häusliche Pflege. Das lehnte der ärztliche Direktor der Valduna, Dr. Josef Vonbun, einen Tag später ab.
Am 17. März 1941 wurde Sr. Rosalia mit 49 weiteren Frauen und 38 Männern von Rankweil in die sog. Heil- und Pflegeanstalt Niedernhart bei Linz deportiert. Von dort kam sie in die Tötungsanstalt Hartheim. In Hartheim war mit Josef Vallaster ein Vorarlberger Nationalsozialist in einer Schlüsselstellung aktiv: Er verbrannte die dort durch Gas ermordeten Menschen mit Behinderungen im eigens dafür errichteten Krematorium. Eines der wenigen überlieferten Fotos der Tötungsanstalt aus der Zeit der NS-Diktatur zeigt die schwarze Rauchsäule des Krematoriums in den Himmel aufsteigen.
Sr. Rosalias Tod wurde am 2. April 1941 durch das Standesamt im deutschen Bernburg mit „Lungenentzündung“ beurkundet. Damit sollte ihr Tod in Hartheim vertuscht werden. Die zuständige Vorarlberger Pfarre dokumentierte ihren Tod abweichend davon mit „Typhus, Kreislaufschwäche“. Den Todesort gab sie mit Hartheim korrekt wieder.
Gedenken an Opfer der NS-Euthanasie aus Hohenems
Für Sr. Rosalia und neun weitere in Hartheim und Niedernhart ermordete Hohenemser Menschen mit Behinderungen errichtete ihre Geburtsstadt Ende November vor dem ehemaligen Armenhaus beim LKH Hohenems ein Denkmal. Von dort waren Menschen nach Hartheim deportiert worden. Im Unterschied zum wenige Wochen zuvor in Götzis angebrachten Erinnerungszeichen an die Ermordeten der NS-Euthanasie aus den Kummenberggemeinden trägt das Hohenemser Denkmal keine Namen. Es gedenkt aller „Opfer der nationalsozialistischen Euthanasie und Verfolgung“, wie es auf dem Stein heißt. Damit verweist das Hohenemser Erinnerungszeichen darauf, dass NS-Euthanasie weit mehr als zehntausendfaches Morden bedeutete: Die NS-Diktatur sterilisierte zumindest 400.000 Menschen mit Behinderungen. Das Gros überlebte diese erzwungene körperliche Verstümmelung. Nach 1945 erhielten sie keine staatliche Entschädigung für derartige Körperverletzungen. In Vorarlberg war eine dreistellige Zahl an Männern und Frauen davon betroffen.
Mehreren tausend schwangeren Frauen mit Behinderungen wurden ihre Kinder ohne ihr Einverständnis durch Primarärzte in öffentlichen Krankenhäusern abgetrieben, unabhängig vom Zeitpunkt der Schwangerschaft. Eine 20-jährige Vorarlbergerin verlor so etwa im September 1942 ihre Tochter im sechsten Monat. Die Abtreibung wurde am Spital Dornbirn vorgenommen, ebenso ihre Sterilisierung.
Ganz ohne Namen gedenkt jedoch Hohenems nicht aller Opfer der NS-Euthanasie: Ihre Vornamen und Lebensdaten sowie ihre Sterbeorte sind global über das Internet auf der Homepage der Stadtverwaltung unter www.hohenems.at/euthanasiedenkmal zugänglich. Dort sind die Ermordeten ebenso wie die Überlebenden genannt. Denn diese gab es ebenfalls; und sie waren ebenso Opfer. Wie die Menschen mit Behinderungen, die unter Zwang unfruchtbar gemacht oder denen ihre Schwangerschaft abgebrochen worden waren.
Es war ein einstimmiger Beschluss der politischen Gremien der Stadt Hohenems, der diesen Weg des Erinnerns an Ermordete, Verstümmelte und Überlebende ermöglichte. Er unterscheidet sich von der in den vergangen Jahren etablierten Fasson des Opfergedenkens wie ihn etwa im Oktober 2019 die Kummenberggemeinden beschritten.
Der Hohenemser Weg macht partizipative Gedenkkultur möglich. Denn mit den genannten biographischen Details der Opfer auf der Homepage der Stadt ist eine Rekonstruktion der Person möglich. Doch es erfordert Teilnahme am Forschungsprozess. Dadurch wird die Verantwortung für das Erinnern nicht nur bei der Gesellschaft oder von ihr nominierten Historiker*innen im öffentlichen Raum verortet, sondern geht dorthin zurück, wo sie auch ihren Platz hat: Bei den Menschen selbst, bei den Angehörigen der Opfer wie der Täter*innen; bei den Zaungästen der Geschichte ebenso wie bei jenen, die sie machen.








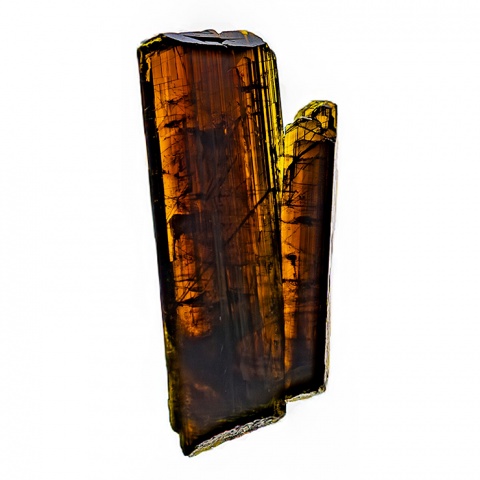






Kommentare